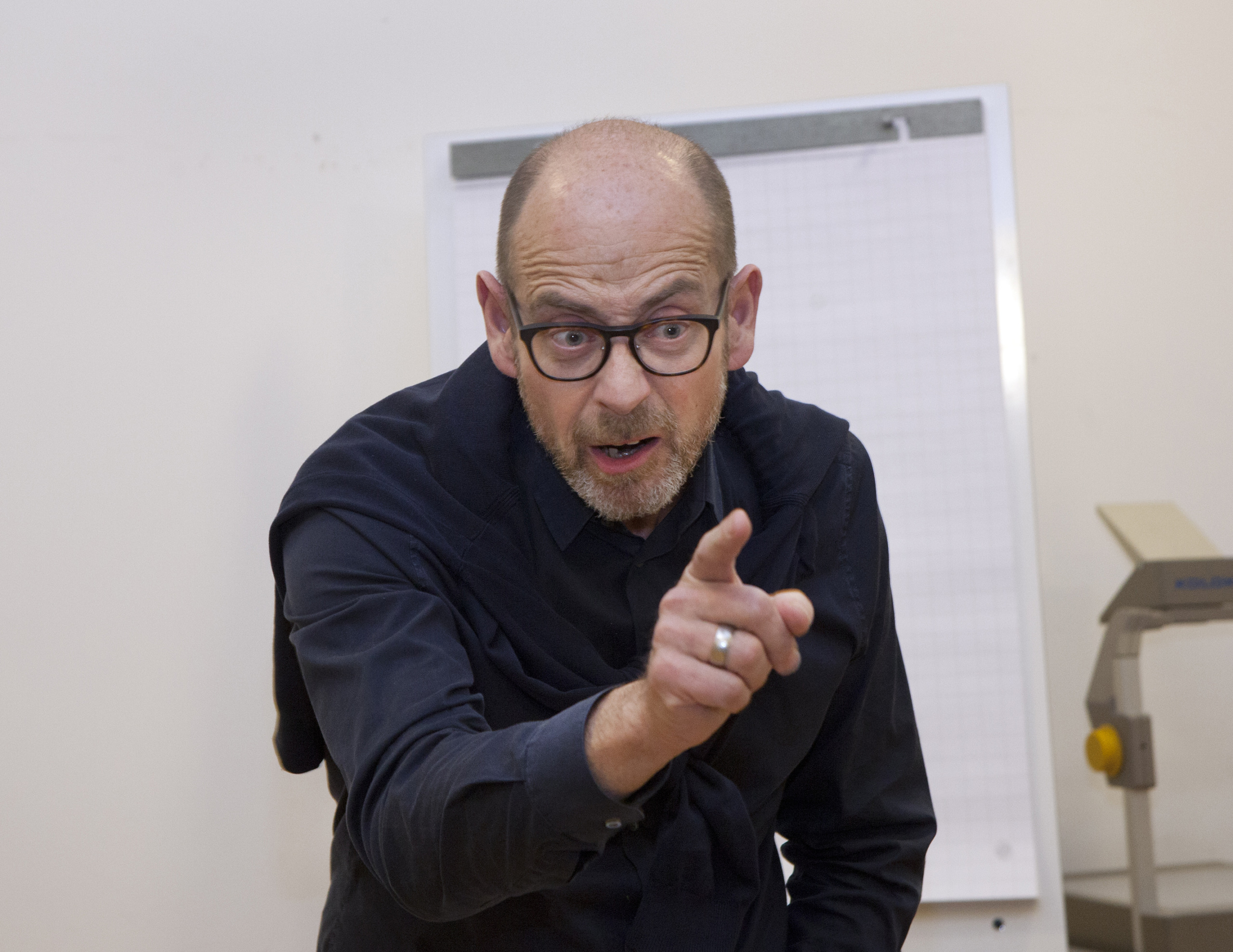Keine falschen Hoffnungen machen
- Susy Mugnes arbeitet als Seelsorgerin im Bundesasylzentrum in Brugg.
- Als Migrantin kennt sie die Bedürfnisse der Geflüchteten.
- Sie fühlt sich mit ihnen verbunden, nicht zuletzt durch ein Gefühl der Ohnmacht.
«Ich bin auch eine Migrantin», sagt die katholische Seelsorgerin Susy Mugnes, die seit 21 Jahren Asylsuchende im Bundesasylzentrum in Basel betreut. Ihre eigene Migrationsgeschichte begann, als sie dreizehn Jahre alt war. Damals wanderte ihre Familie von Italien nach Australien aus. Mit 26 Jahren kam sie zurück nach Europa, um in das Säkularinstitut der Scalabrini-Missionarinnen einzutreten. Ihre Anfänge hatten die Missionarinnen in Solothurn, wo sie die Familien aus Südeuropa betreuten, die zum Arbeiten in die Schweiz gekommen waren. Deren Motto: «Ich war fremd und du hast mich aufgenommen», sei auch heute ihr Auftrag, sagt Susy Mugnes. Seit fast drei Jahren besucht sie auch einmal pro Woche das Asylzentrum in Brugg. Dort ist das Zentrum in den militärischen Hallen der Stadt untergebracht. «Das ist nicht ideal», sagt die Seelsorgerin. Das militärische Umfeld wecke bei vielen Geflüchteten Ängste.
[esf_wordpressimage id=“47049” aspectratio=“1440:1920” width=half float=right][/esf_wordpressimage]
Hinter einem hohen Zaun, zwischen zwei Containern befindet sich der Eingang ins Bundesasylzentrum in Brugg. Dort meldet sich Susy Mugnes an und bekommt ihren Batch, der sie als Seelsorgerin ausweist. Hier endet der gemeinsame Nachmittag mit Susy Mugnes. Das Gespräch mit der Journalistin musste ausserhalb des Geländes stattfinden.
Das wichtigste Bedürfnis der Geflüchteten
Bei einem Kaffee vor der Migros in Brugg hat die Seelsorgerin von ihrer Arbeit berichtet: «Mit dem Eintritt ins Bundesasylzentrum bekommen die Geflüchteten eine Nummer, aber niemand will eine Nummer sein». Darum versuche sie die Menschen im Bundesasylzentrum anzuschauen, zu grüssen und anzulächeln. Gehört und gesehen zu werden, sei das wichtigste Bedürfnis der Geflüchteten.
Rund 30 Männer haben nach der Eröffnung des Zentrums im November 2020 dort gewohnt. Heute sind es fast 400 Männer. Am Anfang seien keine Christen unter den Geflüchteten gewesen. Aber die religiöse Zugehörigkeit der Menschen spiele ihr keine Rolle. Sie ist für alle da. Den einen sei die Religion wichtig, anderen nicht. Manchmal organisiert sie eine Bibel in einer bestimmten Sprache, manchmal einen Rosenkranz, manchmal soll sie für jemanden beten. Meistens hört sie einfach zu.
Die Muttersprache hören
Um mit den Geflüchteten in Kontakt zu treten, lernt Susy Mugnes ein paar Worte in deren Sprache. Sogar ein paar Brocken auf Tigrinja, das in Eritrea gesprochen wird, hat sie gelernt. Die Muttersprache zu hören, zaubere den Geflüchteten manchmal ein Lächeln auf die Lippen. Wie viele Geflüchtete spüre auch sie Ohnmacht, weil sie den Menschen nicht helfen könne, eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu organisieren.
Oft spreche sie auf dem Weg ins Bundesasylzentrum ein Gebet, damit es ihr gelinge, sich ganz die Menschen einzulassen. «Ich bekomme mehr von den Geflüchteten, als ich ihnen geben kann. Sie schenken mir Glaubenszeugnisse und Gottvertrauen.» Etwa durch die Erzählung eines Geflüchteten, der in einem kleinen Boot auf stürmischer See mit den anderen Passagieren in Todesangst gebetet und überlebt hatte.
Die meisten müssen die Schweiz verlassen
Das Dublin-Abkommen bereite den Flüchtenden grosse Probleme, sagt Susy Mugnes. Gemäss diesem Abkommen müssen Asylsuchende dort ein Asylgesuch stellen, wo sie den Schengenraum zum ersten Mal betreten. Das hat in der Schweiz zur Folge, dass die meisten Asylsuchenden das Land wieder in Richtung Italien oder Griechenland verlassen müssen, wo die Umstände für die Geflüchteten oft schlechter sind als in der Schweiz.
Oekumenischen Seelsorgedienst für Asylsuchende (OeSA)
Susy Munges arbeitet für den OeSA. Dieser wird von den Landeskirchen der Nordwestschweiz, der Evangelisch-methodistischen Kirche Basel-Stadt sowie einzelnen Kirchgemeinden und Pfarreien getragen und von privaten Mitgliedern und Spenden unterstützt. Rund 50 freiwillige Mitarbeitende aus den verschiedensten Ländern unterstützen die tägliche Arbeit der Seelsorgenden. Zu den Angeboten gehören neben der Seelsorge, Beratung und Begleitung, ein Café-Treffpunkt, Kinderbetreuung, Spielanimation sowie ein Musikprojekt.
«Ich will den Menschen keine falschen Hoffnungen machen», sagt die Seelsorgerin. Etwas mehr als ein Viertel der Asylgesuche wurden im September dieses Jahres bewilligt. Immerhin werden etwas mehr als die Hälfte der Gesuchstellenden vorläufig aufgenommen und müssen nicht gleich wieder ausreisen. «Nicht für alle wird es hier gut», sagt Susy Mugnes. Ihre Hoffnung ist, dass Gott grösser sei als die Menschen und ihre Gesetze.
Mit einigen Asylsuchenden hat sie auch nach deren Ausweisung noch Kontakt. Vor ein paar Jahren konnte sie einer nach Italien abgewiesenen Frau helfen, dort eine Flüchtlingsorganisation zu finden, die sie unterstützt. Nach einem halben Jahr hat sie einen Aufenthaltsstatus bekommen. Ein bis zweimal pro Tag erreicht sie eine telefonische Nachricht.
Angst und Depression
«Viele leiden unter psychischem Druck, haben Ängste und Depressionen», sagt die Seelsorgerin. Aber für einen medizinischen Beratungstermin warteten die Asylsuchenden zwei, drei Monate. Immer wieder schickten deshalb die Pflegefachpersonen die Geflüchteten in die Seelsorge.
[esf_wordpressimage id=47050 width=half float=right][/esf_wordpressimage]
Um selbst im psychischen Gleichgewicht zu bleiben, tauscht sich Susy Mugnes mit den Kolleginnen beim Oekumenischen Seelsorgedienst für Asylsuchende oder mit ihren Schwestern aus dem Säkularinstitut der Scalabrini-Missionarinnen aus. Auch das Beten helfe ihr. Einmal im Monat begehen die Missionsschwestern einen Wüstentag, ziehen sich zurück, um mit Gott zu sprechen. «Manchmal backe ich aber auch Pizza oder schaue einen Feelgood-Film, um mich abzulenken.»