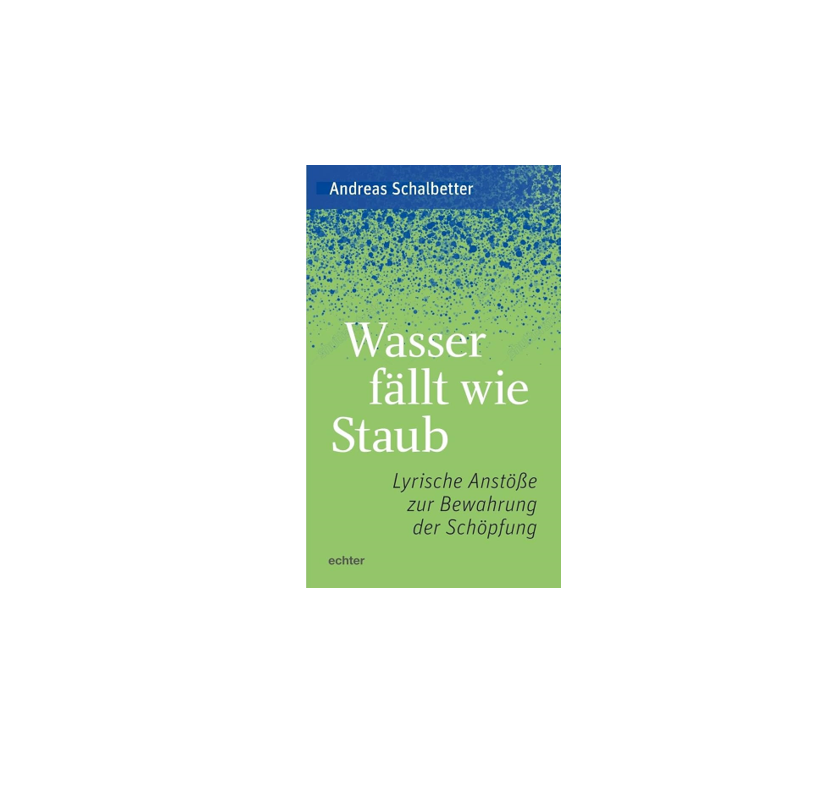Von Judasohren und Teufelsangeln
Von Judasohren und Teufelsangeln
Die Bibel als Namensgeberin für Flora und Fauna
Viele Tier- und Pflanzenarten tragen Namen, die in einem Zusammenhang mit der Bibel stehen. Wie kam es eigentlich dazu? Und um welche Lebewesen geht es da?Für gläubige Menschen sind alle Lebewesen auf der Erde Geschöpfe Gottes. Da darf kaum erstaunen, dass viele Tiere und Pflanzen auch Namen mit Bezug zum Christentum tragen. Oft ist dieser Bezug unauffällig. Wer denkt beim Essen einer Johannisbeere schon an den Täufer? Wer denkt an die Jungfrau, wenn ein Marienkäfer vor einem landet? In anderen Fällen ist die Beziehung zwischen Namen und Religion aber unverkennbar: Den sich aufdrängenden Assoziationen des Namens «Judasohren» etwa kann man sich kaum entziehen.
Benediktiner waren Naturforscher
Die Beziehung von Natur und Religion sind vielfältig und uralt. «Schon im Ursprung des Christentums spielten Naturnamen eine wichtige Rolle», sagt Dieter Kremp. «In der Bibel finden viele Pflanzen Erwähnung.» Der pensionierte Biologielehrer hat dem Phänomen ein ganzes Buch mit dem Titel «Christliche Pflanzennamen» gewidmet. «Viele der heute noch gültigen Pflanzennamen sind direkt auf diese Bibelerwähnungen zurückzuführen», sagt er. Oder andersherum: Die Pflanzen wurden erstmals in der Bibel schriftlich genannt, und die dortige Bezeichnung hielt sich. Eine weitere Ursache für die vielen Bezüge zum Christentum nennt Anette Lukesch in ihrem Buch «Pflanzenwelt und Christentum»: Die ersten Europäer, die sich ausführlich und systematisch mit der Pflanzenwelt auseinandersetzten, waren Benediktinermönche. «Die Pflanzenbücher des Mittelalters waren naturwissenschaftliche Beschreibung und religiöse Erbauung zugleich», so Annette Lukesch. «Es wurde sehr symbolisierend mit den Pflanzen umgegangen.» So entstanden Namen mit theologischer Hintergrundtheorie. Diese verbreiteten sich in der Bevölkerung und halten sich zum Teil, wie etwa im Fall des Johanniskrauts, bis heute.
Sieht aus wie ein Silberling!
Oft führten aber auch profane Äusserlichkeiten dazu, dass der Volksmund christlich geprägte Namen wählte. Etwa bei der Kreuzspinne, die ein Kreuz auf dem Rücken trägt, oder beim Judassilberling, einem Kreuzblütler, dessen Samenschötchen an silbrige Geldstücke erinnern. «Unsere europäische Kultur ist seit 2000 Jahren christlich geprägt», sagt Anette Lukesch. Es überrasche daher nicht, dass viele Symbole der Religion in der Natur wiedererkannt wurden. Es überrascht aber ebenfalls nicht, dass mit der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft viele dieser Verbindungen in Vergessenheit geraten sind. Die Namen aber bleiben, und sie erzählen oft spannende Geschichten.
Erik Brühlmann und Marius Leutenegger