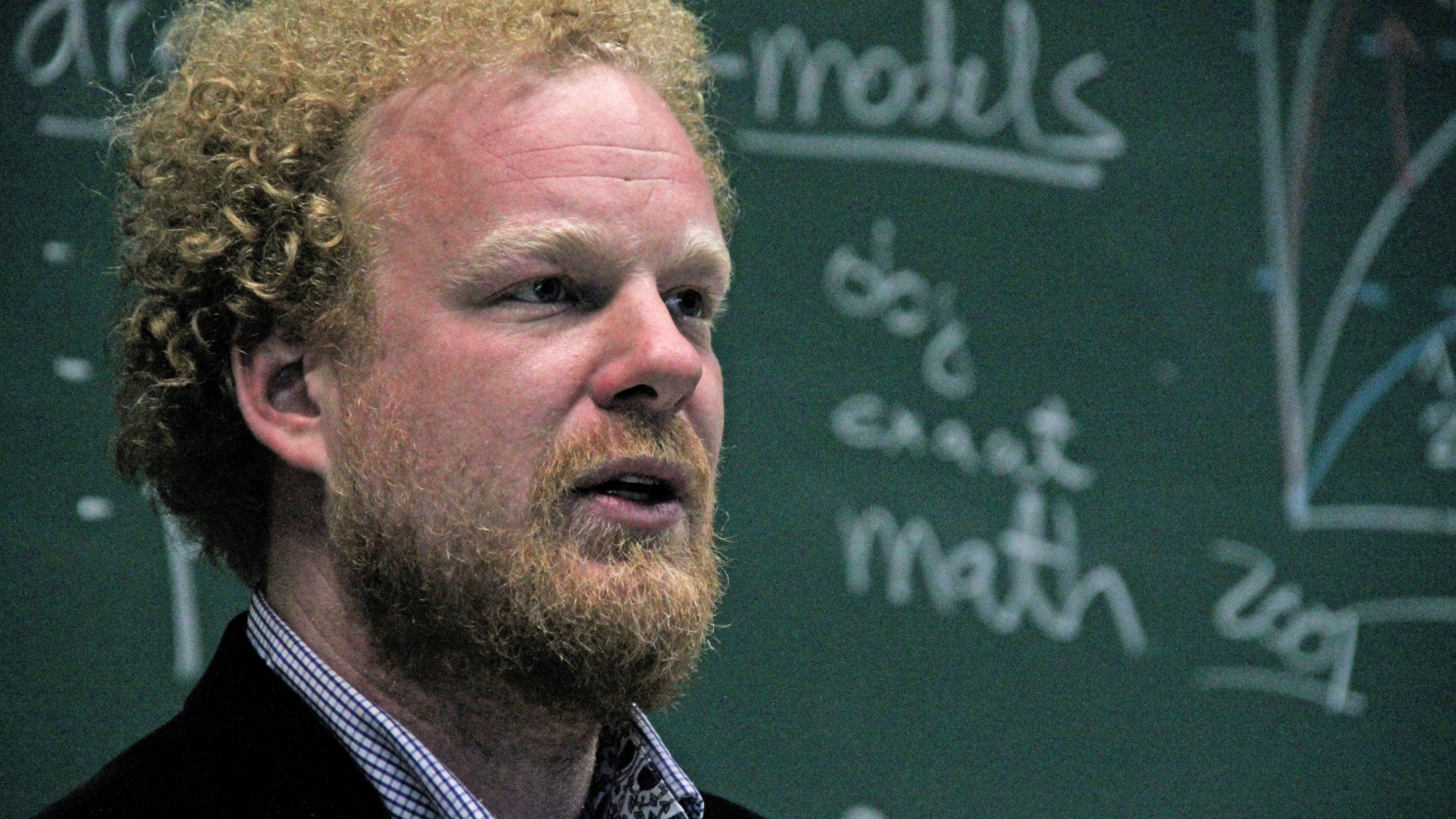Bild / Foto: © Roger Wehrli
Mit Maria von Magdala zu Tisch
Die «Feiern vor der Kirchentür» haben ein neues Format
Was aussieht wie ein Apéro in der Kirche, ist eine Feier, die den Kern des Christseins und die Würde aller Getauften in den Mittelpunkt stellt.
Der 22. Juli ist der Festtag von Maria von Magdala. Maria Magdalena folgte Jesus als Jüngerin und war die erste Zeugin der Auferstehung. Im Aargau wird ihr Festtag seit fünf Jahren regelmässig begangen: Seit Juli 2019 fanden an jedem 22. des Monats Gottesdienste vor der Tür einer Aargauer Kirche statt. Eine eigentliche Protestbewegung unter dem Motto «Maria von Magdala – Gleichberechtigung. Punkt. Amen.». Claudia Mennen, Leiterin der Fachstelle Bildung und Propstei, hat diese Feiern initiiert: «Dass wir vor der Kirchentür feiern, ist ein Akt der Solidarität und des Widerstands. Solidarität mit den Menschen, die aus unserer Kirche noch immer ausgeschlossen sind: wiederverheiratete Geschiedene, gleichgeschlechtlich Liebende oder Frauen, die sich in ein Weiheamt berufen fühlen.»

Schritt über die Schwelle
Nach fünf Jahren und insgesamt 54 Gottesdiensten vor der Kirchentür wagen die Feiern nun den Schritt über die Türschwelle. Fachstellenmitarbeiter Alois Metz sagt: «Leute, die regelmässig draussen mitgefeiert haben, sagten, sie möchten doch auch in der Kirche feiern. Mit der Zeit kam das natürliche Bedürfnis, hineinzugehen und sich den Platz zurückzuholen.»
Zeichen gegen physische und psychische Gewalt
Das Team der Fachstelle Bildung und Propstei hat das Konzept weiterentwickelt. «Mit Maria von Magdala zu Tisch» heisst das neue Motto. Die Mitfeiernden leben ihre eigene Segenskompetenz, indem sie die Speisen auf dem Altar segnen und teilen – als Zeichen für eine neue «Abendmahlsgemeinschaft» gleicher Würde. Zugleich setzen die Feiernden ein Zeichen gegen Machtmissbrauch und gegen psychische und physische Gewalt durch kirchliche Verantwortungsträger oder Strukturen.
Die Fachstelle Bildung und Propstei sucht für die Gestaltung der Feiern die Zusammenarbeit mit den Pfarreien. Im Pastoralraum Aare-Rhein fiel das Anliegen auf fruchtbaren Boden. Der Klingnauer Pfarreiseelsorger Peter Zürn erklärt: «Ich erlebe die Zusammenarbeit hier im Pastoralraum als gleichberechtigt und partnerschaftlich. Dass Männer und Frauen in der katholischen Kirche trotzdem grundsätzlich nicht gleichberechtigt sind, kann hier niemand mehr nachvollziehen.»
Würdig und recht
Im Vorfeld der Feier liess sich das Vorbereitungsteam auf die Geschichte und die biblischen Erzählungen zu Maria von Magdala ein. «Im Mittelpunkt der Vorbereitung stand diese Frau, die im Verlauf der Jahrhunderte historisch unterdrückt und weggelogen wurde», sagt Alois Metz. Das vierköpfige Vorbereitungsteam entwickelte Ideen, wie die Mitfeiernden ihre dreifache Würde als Getaufte erleben können. Alle Getauften und Gefirmten haben die Würde zu verkündigen, die Würde, heilsam zu wirken, und die Würde, Einfluss zu nehmen und zu gestalten. «Ein gemeinsames Teilen von Brot und Wein, sinnlich und menschlich», benennt Alois Metz den Kern der Feier. Es geht um Partizipation, Synodalität und die Bereitschaft, Verantwortung zu teilen. Es geht darum, sich Raum zu nehmen innerhalb der Kirche.
Die Feier in Klingnau begann dennoch draussen vor der Kirche. Dann zogen die Feiernden in die Kirche ein. Sie durchschritten den ganzen Kirchenraum, stiegen hinauf zum Altar und gingen dann weiter in den Chorraum. Peter Zürn sagt: «Wir haben uns den Kirchenraum zu eigen gemacht, den Raum genützt für das, wozu er einlädt. Das hat sich gut angefühlt. Man könnte sagen, es war ‹würdig und recht›.»