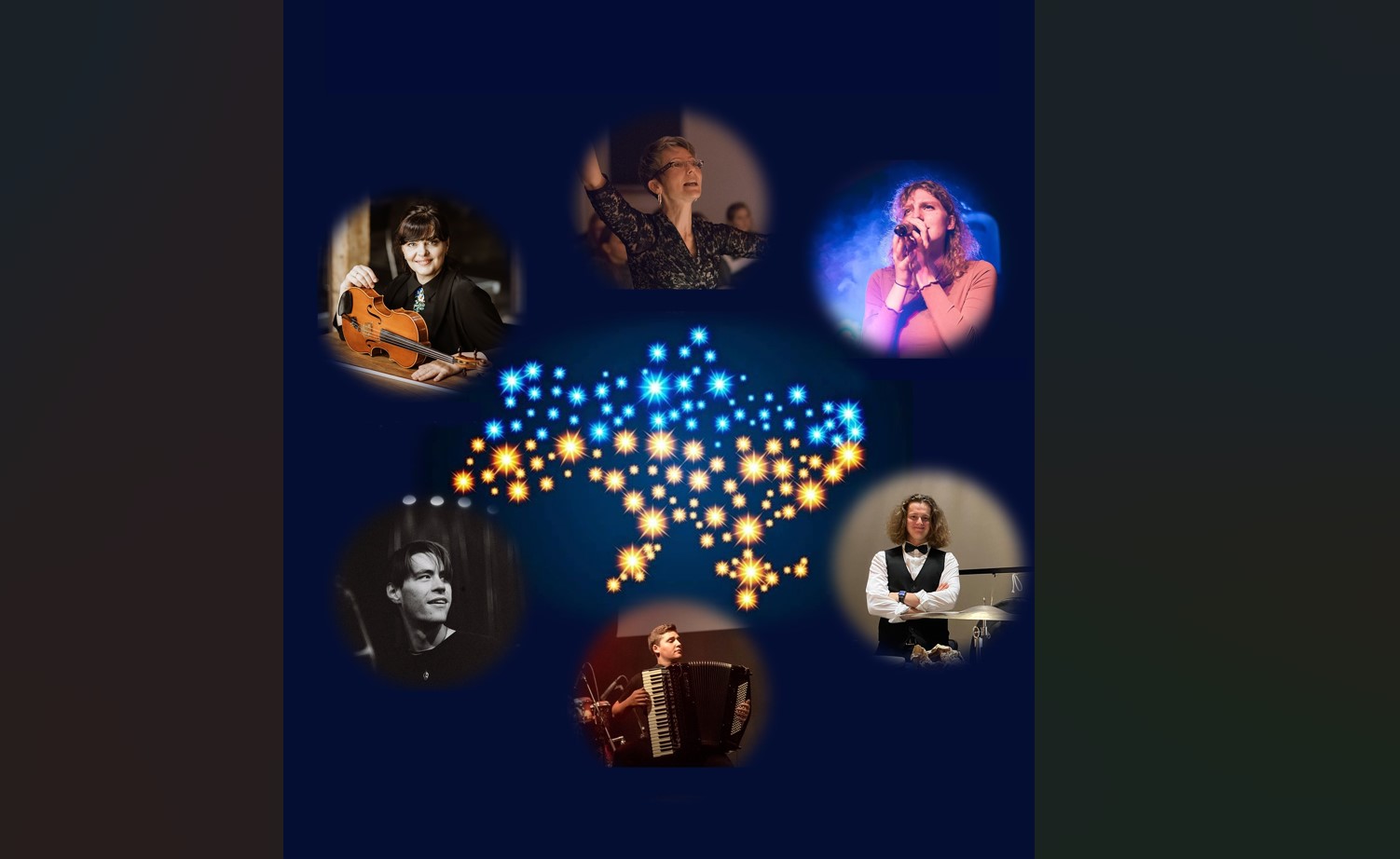Bild: © Werner Rolli
Gegen das Vergessen
Am 6. August 1945 tötete die Atombombe in Hiroshima zehntausende von Menschen
Die Zahl der Menschen, die aus eigener Erfahrung berichten können, was die Abwürfe der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki angerichtet haben, wird täglich kleiner. Die Überlebenden nennen sich Hibakusha und kämpfen mit all ihrer Kraft gegen das Vergessen.
Der 6. August 1945 war ein heisser Tag mit wolkenlosem Himmel. Nachdem die B‑29 mit dem Namen Enola Gay auf der Insel Tinian gestartet war, wurde die Bombe Little Boy um 8.14 Uhr in zehn Kilometer Höhe über Hiroshima ausgeklinkt. 45 Sekunden später detonierte sie rund 600 Meter über der Stadt, tötete zehntausende Menschen und machte die blühende Metropole dem Erdboden gleich.
Sichtbare Erinnerungen
Hidetaka Takigushi erinnert sich: «Ich war fünf Jahre alt. Mein Vater war im Krieg. Meine Mutter, damals 33, lief mit meiner 10 Monate alten Schwester Hiroko und der Verlobten meines Cousins ins Haus, als wir die Motoren der B‑29 Bomber hörten. Als ich die Schiebetüre schliessen wollte, sah ich einen Blitz und fühlte einen brennenden Schmerz in meinem linken Arm.» Die nachfolgende Druckwelle schleuderte ihn ins Innere des Hauses. Takigushi krempelt den linken Ärmel seines Hemds hoch. Noch heute sind die Spuren seiner Verbrennungen sichtbar. Die Familie floh nach Matsunaga, wo sie bei den Eltern der Mutter unterkamen. Die kleine Hiroko überlebte die Strapazen nicht, sie starb am 22. August in den Armen ihrer Mutter.



Lebenslanges Leiden
Kunihiko Iida war da gerade drei Jahre alt und lebte im Stadtteil Kako, etwa 900 Meter vom Hypozentrum entfernt. Zusammen mit seiner Mutter, seiner vierjährigen Schwester und seiner Tante floh er zur Sumiyoshibrücke. Was er da gesehen hat, verursacht bei ihm heute noch Albträume: «Unzählige Menschen lagen im Sterben, verkohlte Leichen lagen überall oder trieben im Fluss. Den Überlebenden hing die Haut in Fetzen von den Leibern.» Kunihiko schaffte es schliesslich mit seiner Familie zum Haus von Verwandten im Dorf Shinjo. Seine Mutter und Schwester litten an Nekrose, speziell an den Beinen. Beide starben innert kurzer Zeit. Für Kunihiko begann, wie er sich ausdrückt, ein «lebenslanges Leiden». Er wurde zu einem Hibakusha, wie sich die Überlebenden selbst bezeichnen.
Einsatz des Roten Kreuzes
Am 6. August und den folgenden Monaten starben Schätzungen zufolge 140’000 Menschen. Die meisten Todesfälle der ersten zwei Wochen waren auf Verbrennungen und akute Strahlungsfolgen zurückzuführen. Von der dritten bis zur achten Woche starben vor allem diejenigen, die einer Strahlung von drei bis vier Sievert ausgesetzt waren durch Organversagen, Blutverlust, unstillbares Erbrechen, blutige Durchfälle, Hautablösungen und Knochenmarksdepression mit Anämie, Infektanfälligkeit und Blutungen. Ab 1947 wurde eine Zunahme an Leukämiefällen beobachtet. Fehlgeburten und Spätfolgen sind nur unzureichend dokumentiert. Hilfe von aussen kam vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Der Schweizer Arzt Marcel Junod erreichte Hiroshima erst im September, mit einem Team des Alliierten Brigadegenerals Thomas Farrel. Sie brachten 15 Tonnen Medikamente. Marcel Junod blieb in der zerstörten Stadt, um die medizinische Hilfe aufzubauen. Am Südeingang des Friedensparks erinnert heute ein Gedenkstein an seine Mission.

Blick flussabwärts auf den Genbaku-Dome in Hiroshima.© Werner Rolli
Opferzahl bis heute nicht geklärt
Die endgültige Zahl der Opfer bleibt bis heute eine Schätzung, die tatsächliche Bevölkerungszahl in den letzten Kriegstagen war unklar, bei der Explosion und den darauffolgenden Bränden verbrannten Dokumente, ganze Familien kamen um und das Sozialsystem brach zusammen. Selbst wer sich nicht in der Stadt aufhielt, war nicht sicher vor atomarer Verseuchung. Isao Sakoda (86) war sieben Jahre alt, als die Bombe fiel. Er lebte 19 Kilometer ausserhalb der Stadt in Ogauchi (heute: Asakita-ku, Hiroshima, Präfektur Hiroshima) in den Bergen. Nach der Detonation von Little Boy stieg der Atompilz bis in 13 Kilometer Höhe und verbreitete hochkontaminiertes Material, das etwa 20 Minuten später als Fallout – radioaktiver Regen, auch Black Rain genannt – niederging, in die Böden eindrang und diese kontaminierte. Auch auf umliegende Dörfer.
Verseuchter Regen
Viele Menschen erhofften sich vom Regen eine Abkühlung oder wollten ihren Durst löschen, schliesslich steigt das Thermometer im August nicht selten über die Dreissig-Grad-Marke. Auch Isao spielte gerne im Freien. Woher hätte er wissen sollen, dass der lang ersehnte Regen verseucht war? Er erlitt keine äusseren Verletzungen und zeigte keine Symptome – bis er 58 Jahre später erkrankte: «Mit 65 wurde bei mir Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Da erst realisierte ich, dass auch ich verseucht worden war.» Langsam würden seine Erinnerungen an diesen Tag verblassen, sagt er, deshalb habe er sich gemeldet, als er vernahm, dass die Motomachi High School mit Hibakusha zusammenarbeitet, um ihre Leidensgeschichte für künftige Generationen in Erzählungen und Bildern festzuhalten. So haben die Studierenden aus seinen und den Schilderungen anderer Hibakusha ausdrucksstarke Bilder gemalt. Isao Sakoda wurde erst 2022 als Opfer anerkannt.

Das Friedensdenkmal für Kinder, der «Tower of a Thousand Cranes». 1955 starb die elfjährige Schülerin Sadako Sasaki an Leukämie. Sie hatte bis zuletzt Papierkraniche gefaltet, denn eine Legende besagt, dass tausend Papierkraniche Glück bringen. Ihre Klassenkamerad/innen gaben den Anstoss zu diesem Denkmal, um Sadakos Seele zu trösten und den Wunsch nach Frieden in die Welt zu tragen. © Werner Rolli
Friedensnobelpreis 2024
Während Jahren wurden die Überlebenden des Atombombenabwurfs stigmatisiert, hatten schlechte Chancen im Berufsleben oder Mühe, eine Familie zu gründen. Manche glaubten, die Strahlenkrankheit sei ansteckend und mieden die Hibakusha. Diese begannen sich zu organisieren in einem Verband namens Nihon Hidankyo. Mit der Zeit setzte sich Nihon Hidankyo nicht nur für finanzielle und medizinische Hilfe der Opfer ein, sondern forderte auch immer deutlicher die weltweite Abschaffung von Atomwaffen. Am 10. Dezember 2024 erhielt diese NGO den Friedensnobelpreis.
Lebenslanges Engagement für eine Welt ohne Atomwaffen
Kunihiko Iida wuchs bei seiner Grossmutter auf. Er absolvierte die Technische Hochschule in Hiroshima, arbeitete für Mitsubishi und als Geschäftsführer von Daiichi Rental Ltd. Sein Trauma hat ihn dazu veranlasst, Psychologie zu studieren. Er warnt unermüdlich vor Atomwaffen, indem er weltweit Vorträge und Testimonials hält. Hidetaka Takigushi fand Kraft in der Fotografie. Er dokumentierte die alten Gebäude vor ihrem Abbruch und fotografierte Bäume, die beim Atombombenabwurf Schaden genommen hatten, aber wieder zu blühen begannen. Isao Sakoda wird sich ebenfalls weiterhin für die Gesellschaft und eine friedliche Welt ohne Atomwaffen engagieren. Er wünscht sich, dass auch die Schweiz den Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, kurz TPNW) unterschreibt. In einem Punkt sind sich die Hibakusha einig: Was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist, darf sich nicht wiederholen und darf nicht in Vergessenheit geraten.