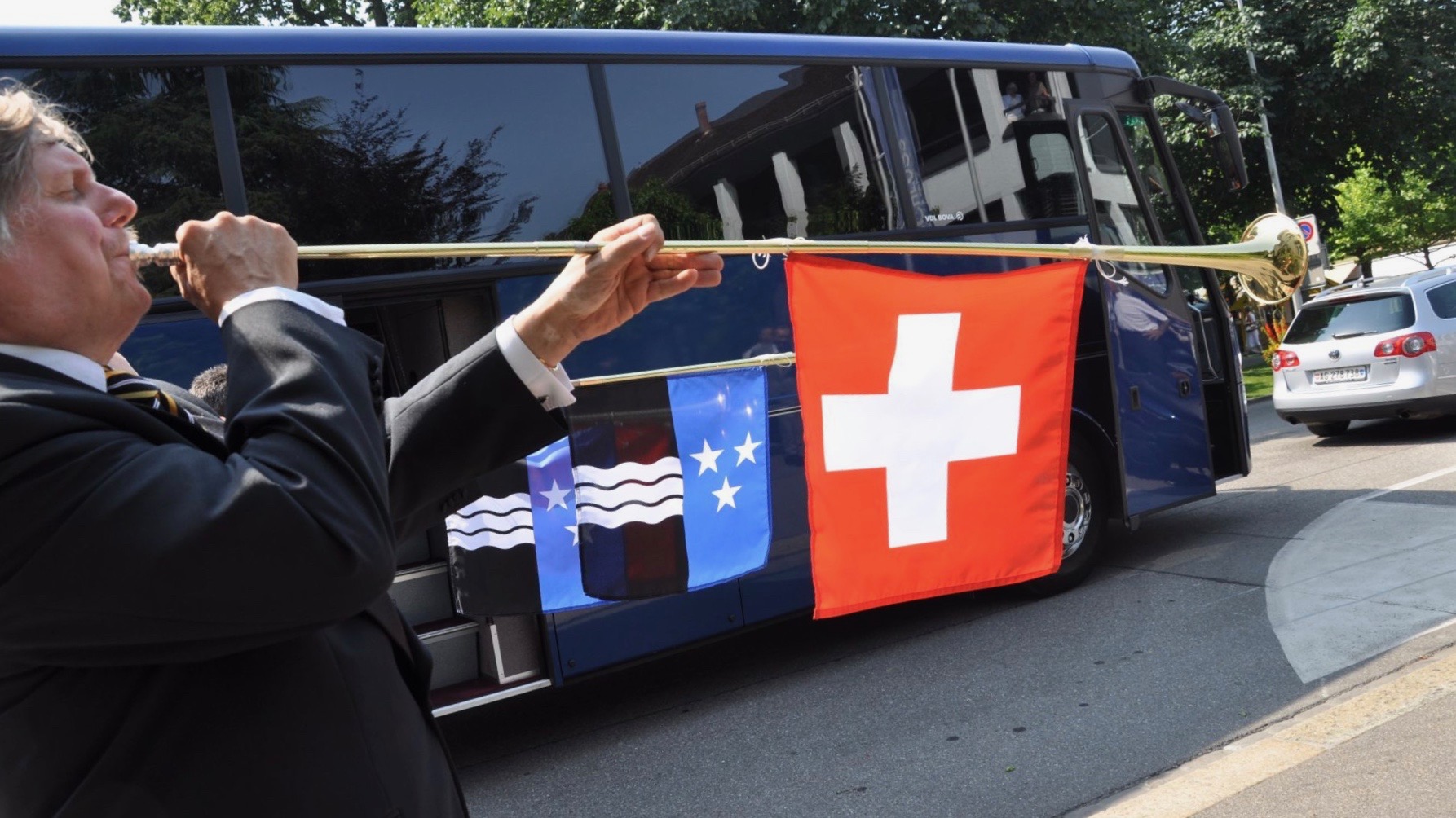Wie im Himmel, so im Aargau
- Nicht nur die römisch-katholische Kirche bemüht sich um eine Erneuerung von innen heraus, auch ihre reformierte Schwesterkirche hat die Zeichen der Zeit erkannt und reagiert.
- Im August dieses Jahres hat die Reformierte Kirche im Aargau ihr Projekt «Kirchenreform 26/30» lanciert, um die Kirche in der heutigen Gesellschaft neu zu positionieren.
- Das Projekt heisst «Wie im Himmel, so im Aargau» und will nicht weniger, als den vorherrschenden Megatrends mit einer glaubhaften Verkündigung des Evangeliums entgegentreten.
Während Papst Franziskus und seine Bischöfe die katholischen Gläubigen rund um den Globus dazu auffordern, sich an der Synode 2023 zu beteiligen (Horizonte berichtet fortlaufend), bleibt auch die reformierte Schwesterkirche nicht untätig; zumindest im Aargau. Die «Kirchenreform 26/30» der Reformierten Landeskirche wurde im August dieses Jahres als Projekt offiziell gestartet. Der ganze Prozess läuft unter dem Namen «Wie im Himmel, so im Aargau». Dieses klingende Motto kam Kirchenratspräsident Christoph Weber in den Sinn, als sich der Kirchenrat bei seiner Retraite über die Ziele einer solchen Kirchenreform unterhielt: «Nachdem das erste Gelächter über meinen Vorschlag abgeklungen war, wurde uns bewusst, dass es genau darum gehen muss in diesem Reformprozess: Was will Gott mit dieser Kirche und nicht, was wollen wir mit dieser Kirche.»
Megatrends als Stein des Anstosses
Die Auslöser für dieses Projekt waren dieselben, die auch die katholische Kirche dazu zwingen, in Sachen Erneuerung aktiv zu werden. Weber spricht von «tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen», von denen beide Kirchen betroffen sind. «Megatrends» nennt die Zukunftsforschung solche Veränderungen, die die Entwicklung einer Gesellschaft auf Jahrzehnte hinaus massgeblich bestimmen. Agilität, Individualisierung, Mobilität, Digitalisierung und Säkularisierung heissen die Megatrends, die heute mit dazu beitragen, dass mit Traditionen gebrochen wird und sich die Bindungen zu religiösen Institutionen auflösen.
[esf_wordpressimage id=35309 width=half float=right][/esf_wordpressimage]Megatrends lassen sich nicht einfach stoppen, geschweige denn umkehren. Was aber will die Reformierte Kirche im Aargau tun, um mit ihrem Reformprozess angesichts dieser starken Strömungen nicht Schiffbruch zu erleiden? Dazu sagt Marc Zöllner, operativer Leiter der «Kirchenreform 26/30» und seit August Mitglied des Teams Gemeindeleitung bei der Landeskirche: «Die Kirchenreform soll die Kirche neu positionieren, gerade im Wissen um die Megatrends.» Und Christoph Weber ergänzt: «Dieser Prozess soll, vor allem jetzt am Anfang, ergebnisoffen sein. Der Kirchenrat gibt keine Ziele vor, sondern moderiert diesen ergebnisoffenen Prozess in der Absicht, einen Dialog mit der Basis zu führen. Wir wollen hören, wie sich die Menschen diese Kirche vorstellen, welche Erwartungen und Wünsche sie haben. So wie der Papst auf den Plakaten der Synode 2023, nur mit dem Unterschied, dass bei uns alle Papst sind.»
«Quick Wins» auf dem Weg zur Reform
In einem zweiten Schritt gehe es dann darum, den Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die notwendigen Reformschritte formuliert und vorangetrieben würden. Als Drittes folgt dann die Anpassung der rechtlichen Grundlagen, etwa der Kirchenordnung, um die Reformen auch umsetzen zu können. Wichtig sei ihnen, so Weber weiter, dass auf diesem Reformweg auch immer sogenannte «Quick Wins» (zu Deutsch: schnelle Gewinne, Erfolge oder Ergebnisse) möglich seien. Die reformierte Kirchenordnung kennt heute schon das Instrument des «Experimentierartikels». Dieser ermöglicht es dem Kirchenrat, einer Kirchgemeinde für die Umsetzung einer Innovation oder neuen Idee grünes Licht zu geben, auch wenn das Experiment sich ausserhalb der geltenden Kirchenordnung bewegt. Wenn der Versuch gelingt und die Kirchgemeinde das in ihrem Bericht nachweisen kann, besteht die Möglichkeit, die neue Praxis in die Kirchenordnung zu übernehmen.
Im August und September fanden in sechs Aargauer Kirchen die regionalen Aufbruchveranstaltungen zum Prozess «Kirchenreform 26/30» statt. Fast 350 Personen, grösstenteils Ehrenamtliche und Mitarbeitende der Kirchgemeinden, nahmen an diesen Anlässen aktiv teil. Das Interesse am Reformprozess ist im reformierten Kirchenaargau gross. Marc Zöllner schildert das weitere Vorgehen so: «Der Kirchenrat hat eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die den Gesamtprozess leitet. Ihr zur Seite stehen acht themenspezifische Arbeitsgruppen, die Sachthemen wie zum Beispiel Dienste, Strukturen, Finanzen, Immobilien et cetera erforschen. Dabei suchen sie das Gespräch mit Experten aus anderen Branchen, um zu erfahren, wie die mit denselben Problemen umgegangen sind. Je weiter weg das von Kirche ist, umso grösser ist die Chance, dass wir eine kreative Lösung finden, die wir bisher noch gar nicht kannten.»
Um auf diesem Weg den Bezug zur Basis nicht zu verlieren, sollen die Arbeitsgruppen, je nach Notwendigkeit, wieder eigene Resonanzgruppen einsetzen, um Erfahrungen und Inputs aus den Expertengesprächen und der eigenen Praxis auch immer wieder zu besprechen. «Es sollen eben keine einsamen Entscheide am grünen Tisch gefällt werden», sagt Zöllner, «sondern es soll auch immer wieder überprüft werden: Wie kommt das an, was wir planen?»
Evangelium glaubhaft vertreten
[esf_wordpressimage id=35307 width=half float=left][/esf_wordpressimage]Wenn alles läuft wie geplant, dann sollen die für die Reform notwendigen gesetzlichen Bestimmungen bis ins Jahr 2026 von der Synode verabschiedet und bis im Jahr 2030 auch umgesetzt sein. Kirchenratspräsident Christoph Weber macht sich und auch den Gläubigen nichts vor: «Dass wir eng mit der Basis zusammenarbeiten heisst noch nicht, dass auch jeder einzelne Wunsch und jede einzelne Erwartung derjenigen, die hier mitarbeiten dann auch eins zu eins in dieser Reform sichtbar werden.» Aber dennoch stehe über allem die Überzeugung, dass «eine reformierte Kirche nur reformiert ist, wenn sie reformfähig ist, wenn sie sich entwickelt.»
Es gehe darum, das Evangelium im Kontext der Gegenwart, in der man stehe, glaubhaft zu vertreten. Und noch eines betont Christoph Weber im Hinblick auf die Ziele der Kirchenreform 26/30: «Ich will nicht mehr nur von der Krise sprechen. Wir verlieren Mitglieder, wir verlieren Kasualien, wir verlieren Gottesdienstteilnehmer, jawohl, das ist wahr. Aber das Ziel einer solchen Reform kann es nicht sein, diese Trends zu wenden. Dann müssen wir gar nicht anfangen. Wir können das nicht wenden. Ich glaube aber, dass wir damit aufhören müssen, traurig, niedergeschlagen oder gar schuldbewusst oder frustriert Kirche zu sein, sondern wir müssen damit anfangen, zu sagen: Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Wir müssen uns fragen: Wie stehen wir zu dieser guten Botschaft? Wir müssen sehen, welche Chancen in der Veränderung liegen und nicht immer nur mit dem Kopf zwischen den Schultern herumlaufen. Wir wollen jetzt freudig und überzeugt für das Evangelium stehen, und ob wir die Trends jetzt wenden können oder nicht, ist eigentlich eher Nebensache.»