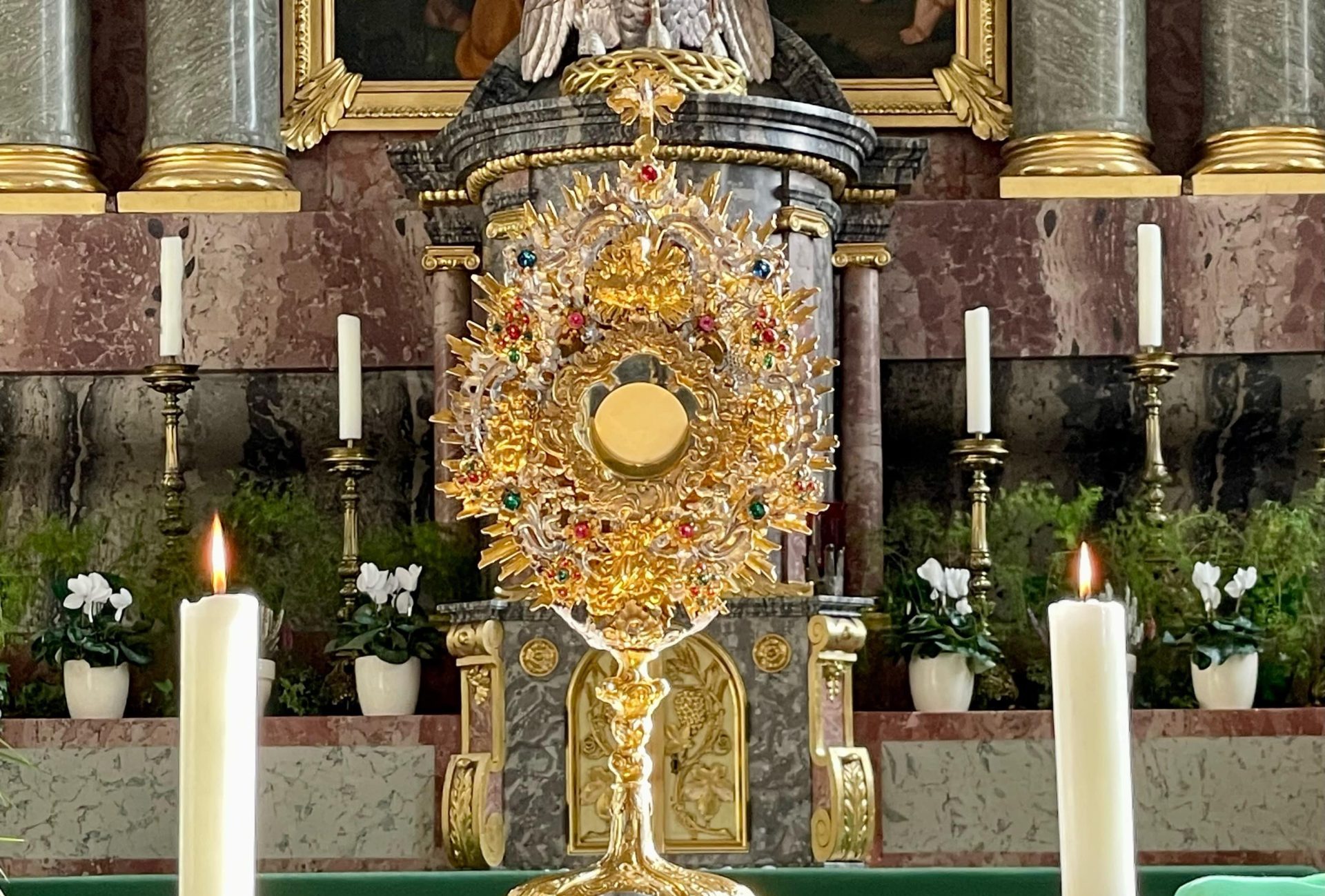200 Jahre Auflösung des Bistums Konstanz
Domherren sind als visionäre Vordenker gefordert
Im August 1821 löste der Papst das Bistum Konstanz auf
200 Jahren nach der Auflösung des Bistums Konstanz leben einige Traditionen weiter – etwa die starke Stellung der Domkapitel. Der Kirchenhistoriker Markus Ries erinnert daran: Die Domherren haben auch eine geistliche Verantwortung. Sie sollten ihrer Aufgabe gerecht werden und der Kirche aus der Krise helfen.Das Bistum Konstanz galt vor 200 Jahren als vergleichsweise liberal. Warum war das so?
Markus Ries: Liberal ist hier eine anachronistische Kategorie. Korrekt ist, dass die Konstanzer Bistumsleitung, viele Angehörige des Klerus und auch Ordensleute eine konstruktive Rezeption der Aufklärung suchten. Und dass sie diese Haltung auch nach den grossen Enttäuschungen und Verlusten der Revolutionszeit beibehielten.
Eine der spannendsten Figuren vor 200 Jahren war Ignaz Heinrich von Wessenberg. Dem Generalvikar des Bistums Konstanz wurde vorgeworfen, gegen den Pflichtzölibat zu sein. Welche anderen Reformdebatten von damals beschäftigen uns auch heute noch?
Viele der damals wichtigen Themen sind seit dem Konzil wieder in den Vordergrund getreten: Beteiligung der Gläubigen an der Liturgie, Aus- und Weiterbildung der Seelsorgenden, kirchliche Medienarbeit, persönliches Format der Seelsorgenden, Qualität von Predigt und Religionsunterricht, ja ganz generell der Verkündigung.
Wenn von Wessenberg gemässigter gewesen wäre: Hätte das Bistum Konstanz länger bestehen können – oder wäre es früher oder später ohnehin aufgelöst worden?
In der Tat spielte der Konflikt zwischen Wessenberg und dem Luzerner Nuntius, einem Teil des Klerus und der Klöster eine wichtige Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt Konstanz ohne diesen Streit immer noch Bischofssitz wäre – und nicht Freiburg. Eine Abtrennung der in Österreich und der Schweiz gelegenen Teile wäre aber so oder so zu erwarten gewesen.
Warum gab es nach dem Bistum Konstanz auf dem Schweizer Territorium nicht ein grosses Bistum? Stattdessen wurde ein Teil vom Stiftspropst von Beromünster und andere Teile von den Bistümern Basel und Chur verwaltet.
Initianten der Reorganisation waren die Kantonsregierungen. Sie strebten zunächst eine grosse Lösung an. Als sie damit beim Nuntius auf Widerstand stiessen, war es rasch vorbei mit der Einigkeit – und jeder Kanton suchte für sich eine optimale, kostengünstige Lösung.
Die Bistümer Basel und St. Gallen haben eine weltweit einzigartige Bischofswahl. In Basel dürfen die Kantone mitreden, in St. Gallen muss der Bischof aus St. Gallen kommen und wird vor Ort gewählt. Wie kam es zu diesen besonderen Privilegien?
Historisch gesehen sind es keine Privilegien, sondern es ist die Weiterführung der Tradition. Dies lag im Interesse der Römischen Kurie. Rom wollte nicht zulassen, dass die Kantonsregierungen das angestrebte Recht zur Bischofsernennung erhielten.
Welche damals entstandenen Spezifika prägen uns noch heute – ausser der öfter genannten Administrationsgebiete im Bistum Chur und St. Gallen?
Spezifisch ist in den Deutschschweizer Bistümern die Verfassung der Domkapitel, die sich stark am kirchlich Gewachsenen orientiert. Die Domkapitel übernehmen nicht einfach die kapitels- und traditionsfeindlichen Grundhaltungen des Kirchenrechts von 1918 und 1983. Spezifisch ist auch der Name des Bistums Basel – es heisst anders als die Bischofsstadt.
Inwiefern ist die Verfassung der Domkapitel fortschrittlicher als das Kirchenrecht?
Die Verfassung unserer Domkapitel ist nicht fortschrittlicher als das Kirchenrecht, sondern sie ist traditionstreuer. Die Domkapitel waren traditionell weit mehr als Wahlmännerversammlungen: Es handelte sich um geistliche Körperschaften mit eigener Verantwortung, denen der Bischof im gewissen Sinne sogar Rechenschaft schuldete.Fast schon eine Art schüchterner Anfang von Teilung der Gewalt. Starb ein Bischof, so trat das Domkapitel in seine Funktion ein und leitete das Bistum. All das hat das Gesetzbuch des Kirchenrechts, der Codex Iuris Canonici, in seinem monarchie-orientierten Organisationsverständnis einfach abgeschafft.
Heute hat man den Eindruck: Die Ernennung zum Domherrn ist eine Art Auszeichnung – auf der man sich ausruht bis zur nächsten Bischofswahl. Sollten die Domherren sich stärker einbringen?
Ja. Domkapitel sind geistliche Korporationen. Falls sie sich tatsächlich auf die Tradition besinnen wollen, müssen sie eigenständig Verantwortung übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, als Vordenker zu wirken, Impulse zu geben und wesentlich die Zukunft mitzugestalten.
Als Ivo Fürer Bischof von St. Gallen und Generalsekretär des Rates der europäischen Bischofskonferenzen war, war die Schweizer Stimme in Europa stärker präsent. Täuscht der Eindruck oder hat das nachgelassen?
Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hat seinen Sitz nach wie vor in St. Gallen. Seine Bedeutung verblasst aus drei Gründen: Erstens: weil inzwischen die 1980 geschaffene Kommission der Bischofskonferenzen der Europäische Union in Brüssel die Verantwortung wahrnimmt. Zweitens: weil der Rat nach wie vor nur die Bischöfe verbindet, statt dass er die Teilkirchen insgesamt repräsentiert. Und drittens: weil er medial nicht präsent ist.
Interview: Raphael Rauch (leicht gekürzte Fassung)