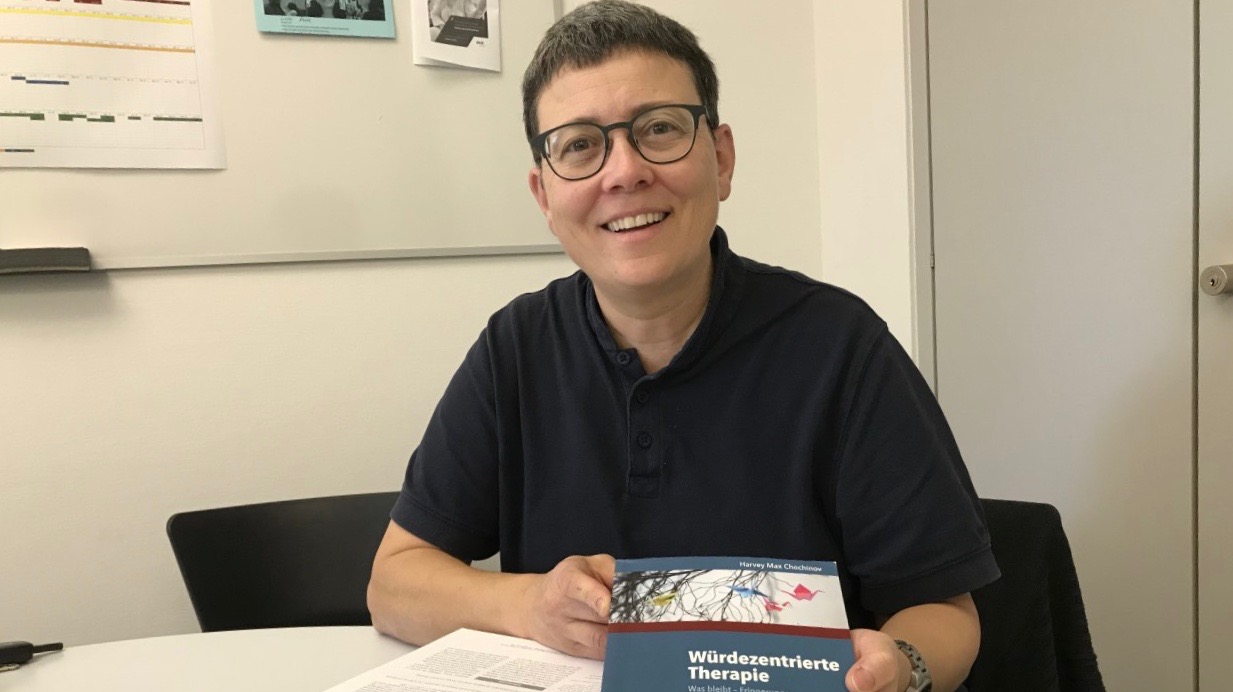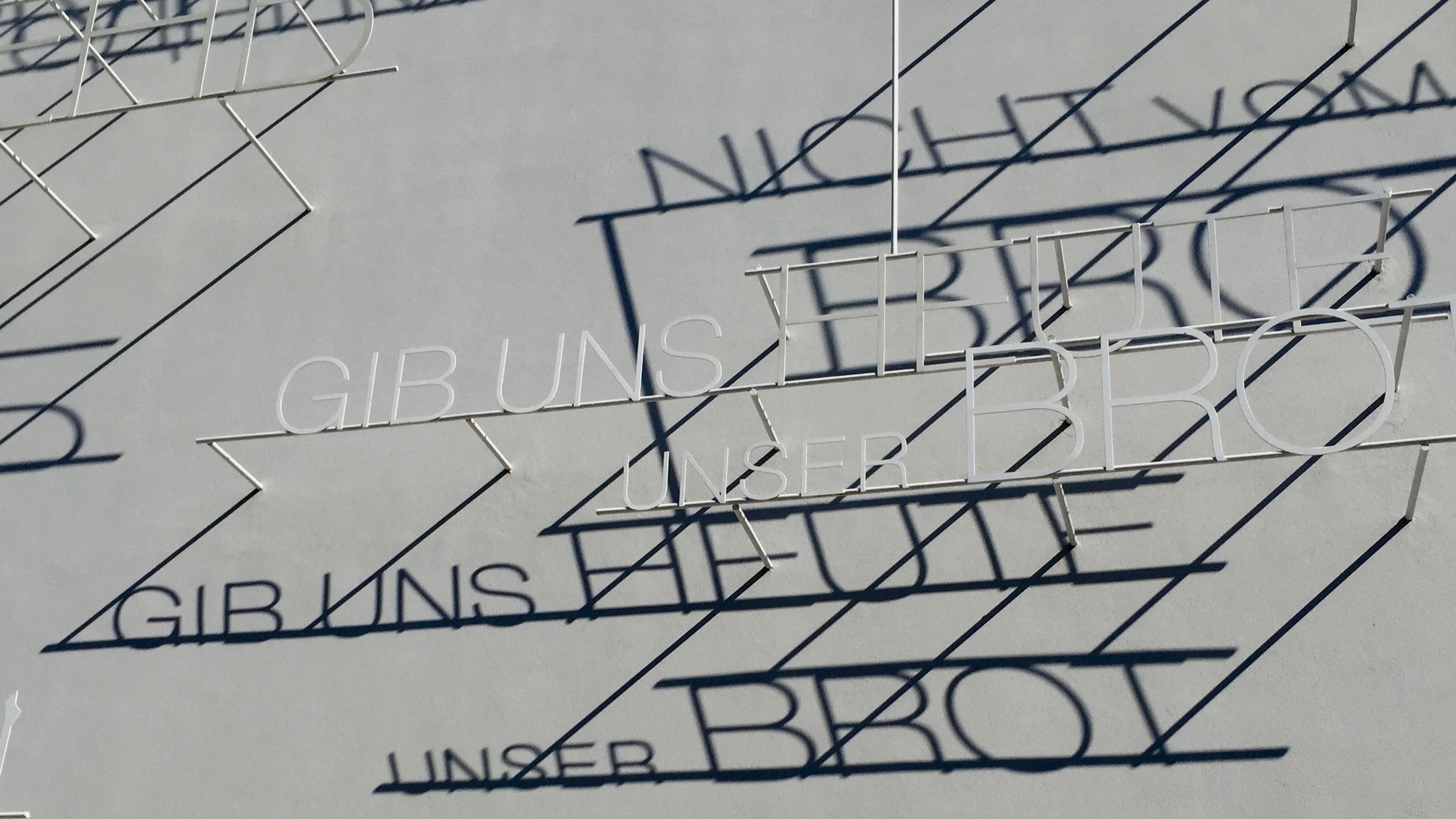
«Säkulare und Religiöse ticken oft gleich»
- Säkular zu sein, sei heute die Norm, sagt der Religionsforscher Stefan Huber, Professor an der Universität Bern.
- Im Interview spricht er über den Unterschied zwischen Säkularen, Säkularisten und Religiösen.
- Die wachsende Konkurrenz zwischen den religiösen Gruppen könnte künftig für Spannungen sorgen, vermutet der Religionsforscher.
Wie meinen Sie das?
Eine Kulturwissenschaftlerin erzählte mir von einem Interview in der ehemaligen DDR, einer der säkularsten Regionen in der Welt. Darin ergab sich folgender Dialog: «Sind Sie religiös?» – «Nö.» – «Sind Sie atheistisch? ” – «Nö.» – «Was sind Sie?» – «Normal.» Das erscheint mir typisch für eine säkulare Haltung, die mehr und mehr zum Mainstream wird. Dadurch setzt die wachsende Gruppe der Säkularen Normen. Radikale Religionsgegnerschaft und starke Religiosität sind heute die Abweichungen.Sie nehmen Säkulare als Untersuchungsgegenstand religionswissenschaftlicher Studien. Macht man sie nicht zu einer religiösen Gruppe, wenn man sie über Religion definiert?
Diese Tendenz versuchen wir mit unserer Studie gerade zu überwinden. Seit 10, 20 Jahren werden die Nicht-Religiösen oder «Nons» zum Forschungsgegenstand empirischer Untersuchungen. Dabei wurde zum Beispiel klar widerlegt, dass Religion für Moral notwendig ist. Auch Nicht-Religiöse tun Gutes. Doch in diesen Untersuchungen werden die Säkularen meist negativ als Nons definiert. In unserem Projekt wollen wir diese Perspektive überwinden und positiv fragen: Was ist ihnen wichtig? Welche Werte und Ziele haben sie? Wie gehen sie mit Sinnfragen um? Wie verstehen sie sich selbst?Wie verstehen Sie Säkulare?
Es geht um Menschen, die von sich selbst sagen, sie seien nicht religiös oder atheistisch. Die Grenzen sind aber nicht eindeutig: Säkulare können durchaus Mitglied einer Kirche oder spirituell sein. Wir wollen den Säkularen keine Definition überstülpen, sondern sie selbst zu Wort kommen lassen. Auf dieser Basis unterscheiden wir verschiedene Typen von Säkularen.Wie ist spirituell in diesem Fall zu verstehen? Oder atheistisch?
Wir fragen zum Beispiel: «Wie oft meditieren Sie?» Oder: «Wie oft haben Sie das Gefühl, mit allem eins zu sein?» Darin kommt Verbundenheit mit einem grösseren Ganzen zum Ausdruck, was typisch ist für spirituelle Erfahrungen. Oder wir wollen wissen: «Würden Sie sich als Atheist bezeichnen?» In vertiefenden Interviews erzählen die Befragten dann, was Atheismus, Spiritualität und Verbundenheitserfahrungen für sie bedeuten.Bezeichnen sich die Leute auch selbst als säkular?
Selten. Der Begriff allein stiftet keine Identität. Das ist anders bei einer besonderen Gruppe von Säkularen, den sogenannten Säkularisten. So definieren wir Säkulare, die sich aktiv für Anliegen wie die Trennung von Kirche und Staat einsetzen. Ein Beispiel sind die Freidenker, die es in der Schweiz seit über 100 Jahren gibt. Bei ihnen spielt das säkulare Selbstverständnis eine identitätsstiftende Rolle.Was haben Sie über die Demografie der Säkularen herausgefunden?
Sie unterscheiden sich nicht sehr vom Bevölkerungsdurchschnitt. Ihr Bildungsniveau ist etwas höher, und sie sind ein bisschen jünger. Säkularisten dagegen haben ein Profil, das deutlich vom Durchschnitt abweicht: Sie sind meist männlich, älter, hochgebildet, politisch eher links, kommen häufig aus der Stadt und arbeiten überdurchschnittlich oft im Bereich der Informatik oder der technischen Wissenschaften.Und was sagen Ihre Erhebungen über die Haltungen aus?
Säkulare und Religiöse ticken oft ähnlich. Zum Beispiel sind ihre Haltungen gegenüber den meisten Religionen vergleichbar. Beide sehen Buddhismus und Hinduismus eher in einem positiven Licht, den Islam dagegen in negativem. Der Hauptunterschied besteht in der Wahrnehmung des Christentums: Die Säkularen sind ihm gegenüber kritisch eingestellt, insbesondere gegenüber den Kirchen. Ein Unterschied zeigt sich auch bei den Werten: Für Religiöse ist Tradition wichtiger, während Säkulare risikofreudiger sind.In einem Artikel vermuten Sie, dass die Spannungen zwischen Säkularen, Säkularisten und Religiösen zunehmen werden. Warum?
Noch vor 40 Jahren gehörten über 90 Prozent der schweizerischen Wohnbevölkerung einer der beiden grossen Landeskirchen an. Das war ein stabiles System. Heute ist dieser Anteil auf etwa 60 Prozent geschrumpft. Die verbleibenden 40 Prozent verteilen sich auf 25 Prozent Konfessionsfreie sowie auf 15 Prozent, die andern Kirchen und Religionen angehören oder unentschieden sind.Wir erleben also eine Pluralisierung der religiös-säkularen Kultur. Dieses System ist instabil. Das stimuliert die Konkurrenz zwischen den religiösen Gruppen, da jede ihren Marktanteil erhöhen oder zumindest stabilisieren möchte. Dazu kommt, dass sich die Säkularisten verstärkt zu Wort melden, was auch zu Spannungen führt.Warum interessieren Sie sich persönlich für die Säkularen?
Das ist eine gute Frage, denn als Professor für empirische Religionsforschung ist eigentlich Religion mein Thema. Es gibt zwei Gründe: Erstens sind die Säkularen heute ein wesentlicher Bestandteil der Kultur in der Schweiz. Will man diese verstehen, ist es unerlässlich, mehr über ihre Werte, ihr Lebensgefühl und ihr Selbstverständnis zu wissen. Zweitens hoffe ich, durch diese Forschung indirekt auch mehr über die Religiösen zu erfahren. Denn in Bezug auf die Säkularen sind sie ja die Nons.Judith Hochstrasser ist Wissenschaftsredaktorin beim Schweizerischen Nationalfonds. Das Interview erschien erstmals im Schweizer Forschungsmagazin «Horizonte» (6. Dezember 2018)