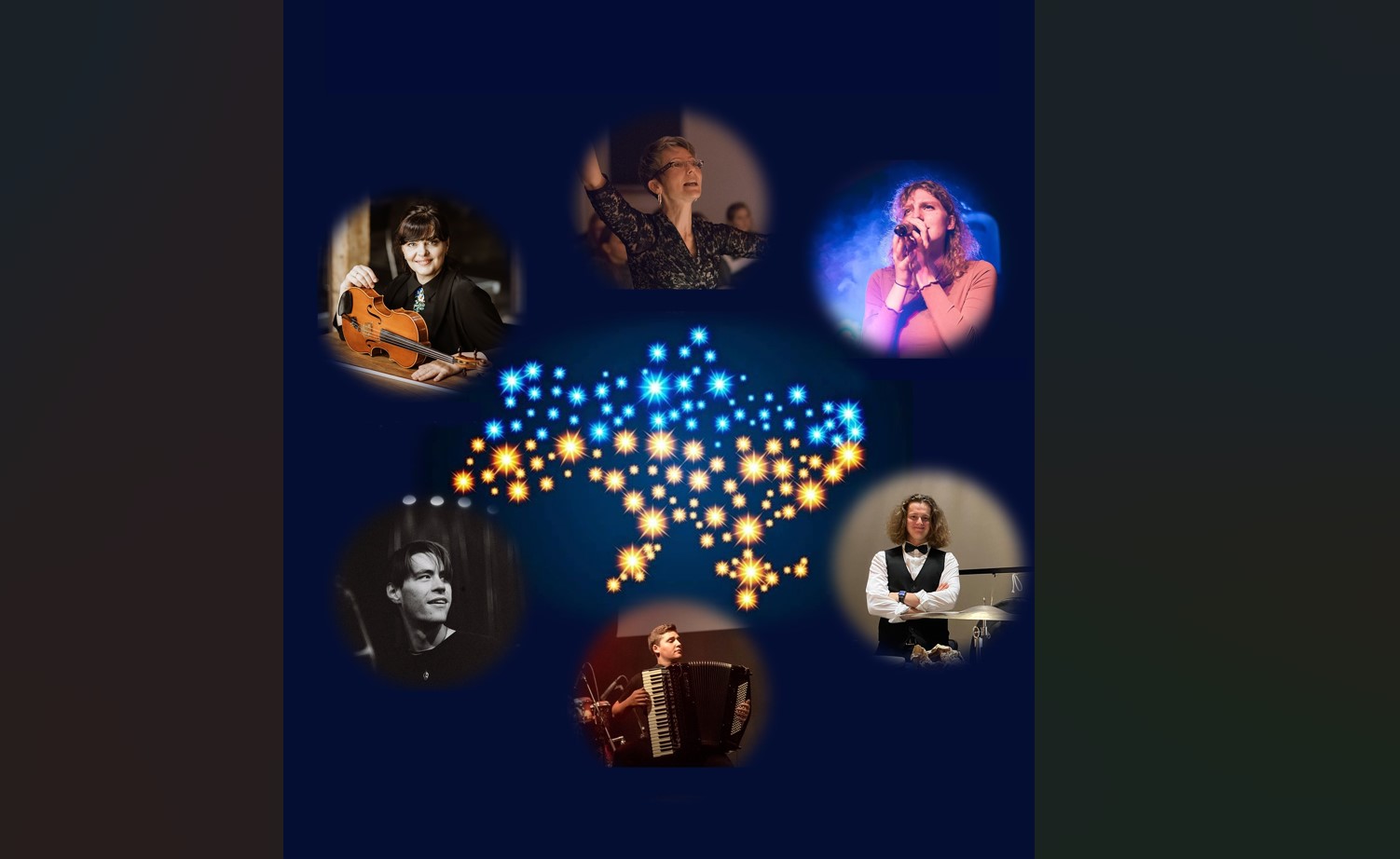Im Kirchenasyl Zuflucht suchen
- Geflüchteten kann das Kirchenasyl wertvolle Zeit verschaffen, um die ihnen zustehenden Rechte voll auszuschöpfen.
- Doch unter welchen Bedingungen ist Kirchenasyl möglich?
- Wie Kirchenratspräsident Luc Humbel dazu steht, lesen Sie im Interview weiter unten.
«Es gibt seit einiger Zeit wieder mehr Anfragen von Menschen, die im Kirchenasyl Zuflucht suchen», sagt Christoph Albrecht, Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes der Schweiz. Der Seelsorger besucht seit 2016 regelmässig das Rückkehrzentrum in Glattbrugg bei Zürich. Dort befinden sich Menschen, die von den Schweizer Behörden einen Wegweisungsentscheid erhalten haben. Immer häufiger befänden sich dort auch Asylsuchende, die aufgrund der Dublin-Verordnung in der Schweiz gar kein Asylgesuch stellen dürfen, sagt Christoph Albrecht. Sie warteten dort auf ihre begleitete Rückreise. Die Menschen in den Rückkehrzentren lebten oft monatelang beengt, ohne Privatsphäre in Containern und verfügten lediglich über den Nothilfe-Betrag von zehn Franken pro Tag, schildert er die Situation der Betroffenen.
Verschlechterung der Situation
Die Situation der Asylsuchenden habe sich verschlechtert, seit Kroatien im Schengenraum sei, sagt Christoph Albrecht. Seine Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk Migrationscharta haben vergangenes Jahr staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen in Kroatien besucht, die sich um die Asylsuchenden kümmern. Die Delegation hat systemische Mängel festgestellt in der Anerkennungsquote der Asylverfahren und bei der medizinischen Betreuung. Zurück in der Schweiz hat das Netzwerk Migration das Staatssekretariat für Migration (SEM) aufgefordert, darauf zu verzichten, die knapp 1000 Asylsuchenden, die in Kroatien zum ersten Mal registriert worden sind, für das Asylverfahren dorthin zurückzuschicken, wie es die Dublin-Verordnung will.
Die davon betroffenen Menschen im Rückkehrzentrum in Glattbrugg berichteten von schlimmen Zuständen in Kroatien, von Pushbacks, mit denen den Flüchtenden an der Grenze zu Kroatien das Recht verwehrt werde, einen Asylantrag zu stellen, erzählt Christoph Albrecht. Pushbacks sind ein Verstoss gegen das Völkerrecht. Der Zürcher Jesuit hört auch Geschichten von Gewalt in den kroatischen Asylzentren. Nach Kroatien wolle niemand zurück.
Kirchenasyl – wie geht das?
Christoph Albrecht hat Erfahrung mit dem Kirchenasyl. Um dessen Sinn verständlich zu machen, erzählt er die Geschichte von Peter, der in Wirklichkeit anders heisst. Peter hatte in der Schweiz einen Asylantrag gestellt, weil er fürchtete, in seinem Herkunftsland ins Gefängnis zu kommen und dort gefoltert oder gar getötet zu werden. Als politischer Flüchtling hätte er seinen Asylantrag aber in dem Schengenland stellen müssen, wo Peter seit einigen Semestern studierte, von dem er aber wusste, dass er in sein Herkunftsland ausgeliefert würde. Die Schweizer Behörden entschieden jedoch, nicht auf Peters Asylgesuch einzugehen. Daraufhin unternahm der Abgewiesene Vorbereitungen für einen Suizid mit der Hilfe von Exit. Die Behörden erhielten Kenntnis von dem Vorhaben und wiesen den jungen Mann für eine Akuttherapie in die psychiatrische Universitätsklinik in Zürich ein. Nach der Entlassung kontaktierte Peter Christoph Albrecht. Dieser gewährte ihm zunächst Aufnahme in der Gemeinschaft der Jesuiten und schliesslich in den Räumen einer Kirchgemeinde. Peter fand sich in einem stillen Kirchenasyl wieder.
Das Kirchenasyl verschafft den flüchtenden Person Zeit, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um ihre Situation zu verbessern. «Das Hauptproblem für Asylsuchende ist nicht nur die Härte der hiesigen Rechtsprechung, sondern auch der schwierige Zugang zum Recht», sagt Christoph Albrecht.
Tradition seit der Antike
Für das Kirchenasyl gibt es keine gesetzliche Grundlage. Seine Tradition reicht aber bis in die Antike zurück. Kirchenasyl ist eine christliche Form des zivilen Ungehorsams. Pierre Bühler, emeritierter Theologieprofessor und Verfasser des Manifests «Kirchen als Asylorte» erinnerte jüngst an einer Tagung in Zürich an das prophetische Wächteramt der Kirchen. An die Pflicht, zu protestieren, wenn der Staat gegen eigene Rechtsprinzipien verstosse. Auf diese Argumentation stützten sich etwa Kirchenmenschen, die sich für die Konzernverantwortungsinitiative stark machten. Diese Art des politischen kirchlichen Engagements stösst jedoch nicht nur auf Zustimmung im Kirchenvolk. Im Nachgang der Abstimmung wurde die Rolle der Kirchen im Abstimmungskampf kontrovers diskutiert. «Seit der Konzernverantwortungsinitiative sind die Kirchgemeinden vorsichtig, sich politisch zu exponieren», sagt Christoph Albrecht. Das habe Zurückhaltung zur Folge auch bei den Kirchenasylen. Wenn diese überhaupt noch gewährt würden, dann fast nur noch still. Auf den öffentlichkeitswirksamen Einbezug der Medien – auf das öffentliche Kirchenasyl – wird verzichtet, um die Behörden nicht zu provozieren.
Kirchenasyl ist keine Hexerei
Auch die Kirchen gewähren Asyl nur auf Beschluss entsprechender Gremien. Das duale System der katholischen Kirche mit der staatskirchenrechtlichen und der pastoralen Seite macht die Organisation des Kirchenasyls zwar komplexer, aber es hilft auch zur klaren Aufteilung unterschiedlicher Rollen. Nicht nur die kirchlichen Entscheidungsträger müssen genau wissen, worauf sie sich einlassen. Auch die Asylsuchenden brauchen eine minutiöse Aufklärung darüber, was es bedeutet, in einem Kirchenasyl zu leben. Die Lebensbedingungen in diesem Status sind streng, der Bewegungsradius ganz klein. Asylsuchende im Schutz der Kirche können weder Nothilfe noch Sozialhilfe beziehen. Sie sind fast gänzlich abhängig von der Kirchgemeinde. Zudem besteht die Gefahr, dass sie trotz gegenteiliger Absichten öffentlich exponiert werden. Finde ein Kirchenasyl dennoch statt, sei dieses aber oft auch für die Kirchgemeinde oder die Pfarrei mit ihren freiwilligen Helfenden eine bereichernde Erfahrung. Man könne das Kirche sein in hohem Mass als sinnhaft erleben. «Kirchenasyl ist keine Hexerei», sagte Christoph Albrecht an der erwähnten Kirchenasyl-Tagung. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk Migrationscharta ermutigte er die anwesenden Pfarrpersonen, Mitglieder von kirchlichen Behörden, haupt-amtlichen und freiwilligen engagierten Menschen, das Kirchenasyl auch in der eigenen Pfarrei oder Kirchgemeinde zu prüfen. Als Christinnen und Kirchen seien wir zuallererst dem weltweiten Reich Gottes verpflichtet, das keine Landesgrenzen und Ausgrenzung kenne.
Kirchenratspräsident Luc Humbel zum Kirchenasyl
Haben Sie Kenntnis von einem Kirchenasyl im Kanton Aargau?
Luc Humbel: Mir ist kein Fall bekannt, der sich während meiner vierzehnjährigen Tätigkeit als Kirchenratspräsident zugetragen hat.
[esf_wordpressimage id=43416 width=half float=left][/esf_wordpressimage]
In welchen Situationen halten Sie ein Kirchenasyl für gerechtfertigt?
Dazu gibt es ein Grundlagenpapier der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz (RKZ). Daran halten wir uns von der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau. Aus diesem Papier geht hervor, dass der Anwendungsbereich eines Kirchenasyls sehr eng begrenzt ist, weil wir in der Schweiz einen funktionierenden und gut ausgebauten Rechtsschutz haben.
Angenommen eine Kirchengemeinde oder Pfarrei würden ein Kirchenasyl gewähren wollen. Auf welche Unterstützung seitens der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau könnten sie zählen?
Wir wären darauf bedacht, dass der Entscheid gut abgewogen wird unter Einbezug beider Seiten des dualen Systems. Weder ein einzelner Seelsorger noch eine einzelne Kirchenpflegerin dürfte den Entscheid alleine fällen. Wir würden auch anregen, die Haltung der Kirchgemeinde oder allenfalls des Pfarreirates in den Entscheid miteinzubeziehen.
Die Landeskirche würde also vor allem vermitteln?
Vor allem würden wir erklären, was das Kirchenasyl ist. Es ist weder kirchenrechtlich noch staatsrechtlich verfasst. Das Kirchenasyl hat klare Grenzen. Es gilt zu beachten, dass ein solches Engagement nicht vorschnell, zwar aus einem guten Willen heraus entstanden, in einer Sackgasse landet.
In Deutschland werden jährlich mehrere Hundert Kirchenasyle gewährt. In der Schweiz sind es eine Hand voll. Warum ist das so?
In der Schweiz gibt es fast keine Anwendungsfälle. Für mich wäre ein praktischer Anwendungsfall, wenn kleine Kinder während eines laufenden Verfahrens ausgeschafft werden sollten. Dann würde ich verstehen, dass sich die Kirche für das Bleiben der Kinder engagiert, um einen Gerichtsentscheid abzuwarten. Im Rahmen ordentlicher Asylentscheide sehe ich keine Notwendigkeit eines Kirchenasyls. Wir sind als Kirche nicht legitimiert, staatlich gefällte Entscheide auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen.
Wie sieht es mit den Dublin-Fällen aus, die in Länder zurückgeschafft werden sollen, in denen sie zuerst registriert wurden, wo sie bekanntermassen wenig Chance auf einen ordentlichen Asylprozess haben, wie etwa die Berichte aus Kroatien zeigen?
Auch hier ist die Kirche aus meiner Sicht gehalten, das staatliche Recht und die Anordnungen zu respektieren.
Was denken Sie über das prophetische Wächteramt der Kirche, das den Staat mahnt, wenn er seinen Rechtsprinzipien nicht gerecht wird?
Im Rückblick auf die vergangenen Ereignisse (Luc Humbel spielt auf den Missbrauchsskandal an) sind wir gut beraten, wenn wir die eigenen Ansprüche nicht überhöhen, wenn wir sie selbst nicht erfüllen.
Wäre das Ausüben dieses Amtes nicht auch eine Möglichkeit, wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen?
Dazu ist der Asylbereich der falsche Fokus, weil wir ausgesprochen gute Rechtswege haben. Die Kirche könnte sich aber aktiver einbringen in Wertediskussionen.
Interview: Eva Meienberg