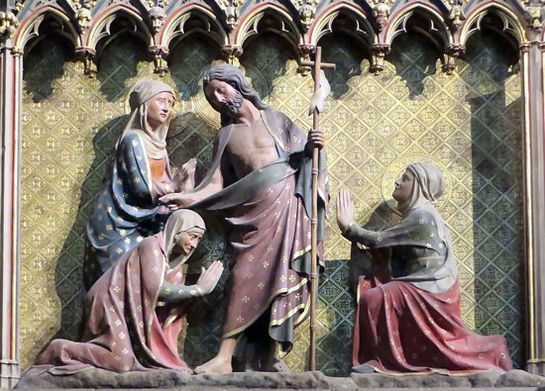Die Heimatlosen – am Rand der Gemeinschaft
Die Heimatlosen – am Rand der Gemeinschaft
Der Heimatlosenplatz bei Anwil, Kienberg und Wittnau erinnert an einen bitteren Sozialkonflikt
Im Dreiländereck von Baselland, Solothurn und Aargau existierte bis 1931 ein kleines Gebiet, das zu keinem Kanton gehörte: der Heimatlosenplatz. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts versteckten sich häufig sogenannte Heimatlose in Wäldern abseits der Dörfer.Seit 1400 und definitiv seit 1534 gehört das Dorf Anwil zu Basel, das Nachbardorf Kienberg seit 1523 zu Solothurn, während Wittnau bis 1798 mit dem Fricktal zum habsburgischen Vorderösterreich gehörte und 1803 dem neuen Kanton Aargau angeschlossen wurde. Dennoch stossen die drei Kantone BL, SO und AG erst seit 1931 in einem Punkt aneinander. Zuvor trennte sie ein schmaler, dreieckiger Spickel Land von 63 Aren Fläche, der zu keiner der drei Gemeinden und zu keinem Kanton gehörte – ein staatenloses Gebiet.Zum grössten Teil war dieses an einem steilen Hang gelegene Land Wald, zu einem kleinen Teil auf der Anwiler Seite Wiese. Die privaten Grundbesitzer mussten für ihre Parzellen in diesem Gebiet keinem Gemeinwesen Steuern zahlen. Keine Verwaltung und keine Polizei konnten dort Hoheitsrechte ausüben, zum Beispiel die Jagd regeln. Die Kantone vertraten die Ansicht, dieses Gebiet gehöre gar nicht zur Schweiz.
Okkupation durch die Schweiz
Dieser Zustand ging wohl ins Ancien Régime zurück. Wie und wann er entstanden war, ist unbekannt. Erstmals aktenkundig wird die sonderbare Situation im Jahr 1822. Damals wollten die drei Gemeinden das Gebiet aufteilen, wurden sich aber nicht einig: «Die Weitnauer haben nicht füren wollen, die Kienberger nicht hindern und die Anwiler nicht aben» (d.h. die Wittnauer wollten nicht nach vorn, die Kienberger nicht nach hinten und die Anwiler nicht nach unten – keine Gemeinde war bereit, sich zu bewegen), heisst es im Protokoll des Gemeinderats von Anwil 1823. Gut hundert Jahre später nahmen die Kantone einen neuen Anlauf und schlossen am 27. März 1931 einen Vertrag, mit dem sie das Gebiet entlang von privaten Grundstückgrenzen aufteilten. Erst jetzt stiessen die drei Gemeinden und die drei Kantone zusammen. An diesem Punkt setzten sie den dreikantigen Granitstein mit der Nummer 257 (siehe Bilder).Damit war die altertümliche Besonderheit eines staatenlosen Gebiets bei Anwil, Kienberg und Wittnau beseitigt. Die Regeln einer hoheitlichen Verwaltung galten nun auch auf dem Heimatlosenplatz. Der Bund genehmigte den Teilungsvertrag der Kantone, wobei die Juristen des Aussenministeriums in Bern den Vorgang als völkerrechtlich legale Okkupation einstuften.
Erinnerung an die «Heimatlosenfrage»
Die Behörden und die ansässige Bevölkerung der Umgebung bezeichneten das exterritoriale Kuriosum im 19. Jahrhundert mit verschiedenen Namen: «In der Freyheit», aber auch «Vagantenplatz» und «Heimatlosenplatz». Dieser letzte Name war von 1877 bis 1900 auch auf der Landeskarte der Eidgenössischen Landestopographie eingetragen. Er wird im Vertrag von 1931 verwendet und ist bis heute gebräuchlich, wenn von diesem Thema die Rede ist, manchmal in mundartnahen Schreibweisen wie Heimatlosenplätz oder Heimetloseblätz.Der Name erinnert an ein dominierendes Thema in der Schweiz der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als
Heimatlose galten Menschen ohne Bürgerrecht einer Gemeinde, zum Beispiel Fahrende oder Bettler. Sie waren weitgehend rechtlos. Die «Heimatlosenfrage» wurde dann vom jungen Bundesstaat im Heimatlosengesetz von 1850 angepackt.
Oltinger Landjäger schiesst scharf …
Die Beziehungen zwischen Sesshaften und Heimatlosen waren voller Konflikte. Eindrücklich zeigen das zwei Quellen aus dem Baselbiet, die der Historiker Michael Blatter in der Fachzeitschrift
«Traverse» (2007/2) veröffentlicht hat. In einem Rapport vom 18. März 1838 beschreibt Landjäger Eglin vom Grenzposten Oltingen, wie er nachts auf Patrouille ein Lagerfeuer im Wald zwischen Wenslingen und Rothenfluh entdeckte und zusammen mit Wächter Gysin Jagd auf die Heimatlosen machte, die er als «eine Partie Lumpenpack» und «Bettelgesindel» bezeichnet. Aus einer Distanz von weniger als 100 m schossen beide auf die Gruppe von «drei oder vier Mannspersonen» und «ein paar Weibsbildern». «Aber wir wissen nicht, ob wir Einen getroffen haben oder nicht, denn es war wohl weit.» Die Angegriffenen flohen oder versteckten sich vor den Grenzwächtern. «Wir vermuteten, dass sie gegen Anwil geflohen seien und über die Grenzen in den Kanton Aargau oder Solothurn», schreibt Landjäger Eglin.
… und Doktor Rippmann klagt an
Nur drei Monate später, am 20. Juni 1838, notierte der Arzt Dr. Rippmann von Rothenfluh in sein Tagebuch, dass er von einem 16-jährigen heimatlosen Mädchen zu dessen sterbenskrankem Bruder in den Wald «auf dem Berge oben» geholt worden sei. In wenigen Kilometern Entfernung vom Dorf fand der Arzt in unwegsamem Gelände, wohl nahe der Grenze gegen Wittnau, «auf einem Lager von Baumästen, mit elenden Lumpen bekleidet, einen abgezehrten, blassen Mann von ungefähr 24 Jahren, auf dessen Gesicht sich die furchtbarsten Schmerzen und Leiden abspiegelten, verbunden mit einem Zug tiefster Trauer und Schwermut». Beim Lagerplatz befand sich die Gefährtin des Kranken mit einem fünf Wochen alten Säugling und zwei weiteren Kindern, dazu mehrere andere Frauen und Kinder. Die Hilfe des Arztes kam zu spät: «Zu seiner Wiedergenesung war keine Hoffnung da, doch verliess ich ihn, nachdem ich getan, was ich für den Augenblick tun konnte», schreibt Rippmann. Am Tag danach war der Mann tot.Rippmann war offenbar ein politischer Kopf, denn in seinem Tagebuch klagte er die Behörden an, die die Heimatlosen «gleich dem Wild Tag und Nacht gejagt und gehetzt» hätten und sie ohne Verpflegung und ärztliche Versorgung jeweils an die nächste Kantonsgrenze setzten. Das Gesetz verunmögliche den Heimatlosen auch Tagelöhnerdienste für die Sesshaften. Das von ihm angetroffene «Schmerzenslager» im Wald beelendete den Arzt dermassen, dass er glaubte, dessen Anblick wäre «selbst für die Tagsatzung ein Sporn zur schnellen Abhilfe dieses Jammers gewesen».
Krankensalbung ja, Beerdigung nein
Auch von der Einstellung der Heimatlosen zur Religion und vom Verhalten der kirchlichen Amtsträger vermittelt der Tagebucheintrag von Dr. Rippmann einen Eindruck. Offenbar waren die Leute in dem Lager katholisch, denn sie holten den katholischen Pfarrer aus Wittnau zu dem Sterbenden. Dieser kam, begleitet von einem Bewaffneten, und spendete die Krankensalbung. Laut Rippmann nahmen die «ohne allen Unterricht selbst in der Religion» aufgewachsenen Heimatlosen daran mit einer «Inbrunst und Andacht» bei, «die manchem unter uns zum Muster dienen dürfte».Die Bestattung des Verstorbenen auf dem Friedhof von Wittnau wurde aber verweigert, «denn man fürchtete Unkosten», wie Rippmann schreibt. Stattdessen liess man den Toten im Sarg ins reformierte Rothenfluh tragen, «wo Herr Pfarrer Lichtenhahn auf gewohnte Weise und unter Beisein vieler Ortsbewohner die Leiche feierlich begleitete und eine rührende Rede hielt. Kaum war diese beendigt», fährt Rippmann fort, «wurde die ganze Gesellschaft der Heimatlosen auf einen Wagen gesetzt und dem Bezirkshauptorte Sissach zugeführt, um über die Grenze einem anderen Kanton zugeschoben zu werden.»
Warum der Name «Heimatlosenplatz»?
Der Rapport von Landjäger Eglin und das Tagebuch von Doktor Rippmann belegen, dass die Sesshaften an den Kantonsgrenzen von Baselland, Solothurn und Aargau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund um ihre Dörfer jederzeit auf Heimatlose treffen konnten, besonders im Wald. Wenn sie das zu keinem Kanton gehörende Landstück «Vaganten-» oder «Heimatlosenplatz» nannten, kam diese Bezeichnung aus ihrer Lebenserfahrung. Das bedeutet nicht, dass auf diesem «Blätz» besonders häufig oder gar regelmässig Heimatlose gelagert hätten. Im Gegenteil: Von einer Begegnung mit Heimatlosen auf diesem kleinen, schmalen und abschüssigen Landstreifen ist kein einziges Zeugnis bekannt – im Unterschied zu den Wäldern der umliegenden Aargauer, Baselbieter und Solothurner Gemeinden, wo sich genügend versteckte Lagerplätze anboten.Zwar mussten die Heimatlosen dort überall mit Vertreibung und sogar mit Angriffen auf ihr Leben rechnen, wie der Rapport Eglin zeigt. Doch der abgelegene Heimatlosenplatz hätte ihnen keinerlei Schutz vor dieser Verfolgung bieten können: Landjäger Eglin hätte kaum gezögert, auf die Bettler zu schiessen, wenn er sie von Anwiler Boden aus auf dem Heimatlosenplatz entdeckt hätte. Denn gerade dort hätte er keine Strafe von der Obrigkeit eines andern Kantons befürchten müssen. Rettung vor akuter Verfolgung konnte für die Heimatlosen nicht der herrenlose Spickel bringen, sondern vielmehr das Ausweichen über die Grenze auf das Gebiet eines andern Kantons. Denn auf Solothurner oder Aargauer Boden durfte der Oltinger Landjäger Eglin nichts ausrichten, wenn ihm das «Lumpenpack» entwischte.Der Name Heimatlosenplatz kann deshalb nicht so verstanden werden, dass die Heimatlosen dort über einen sicheren Platz verfügten, wo sie sich unbehelligt von staatlichem Zugriff hätten aufhalten können. Das wäre eine romantische, realitätsferne Vorstellung. Eher könnte die Bezeichnung den Wunsch der sesshaften Bevölkerung ausdrücken, die Heimatlosen sollten sich doch in dieses unwirtliche «Niemandsland» begeben und sich vor allem von jedem Gemeindegebiet fernhalten. Vielleicht ist der Name aber auch scherzhaft gemeint, weil das fragliche Gebiet selber «heimatlos» war und keiner Gemeinde angehörte – genau wie die Heimatlosen. Der Name «In der Freyheit» wiederum, auf einem Grenzplan von 1837 eingetragen, dürfte sich eher auf die Steuerfreiheit der Grundbesitzer beziehen. Denn für die Behörde, die einen solchen Plan erstellte, war die Steuerpflicht gewiss von grösserer Bedeutung als die «Freiheit» der Heimatlosen.
Christian von Arx [esf_gallery columns=“3”]