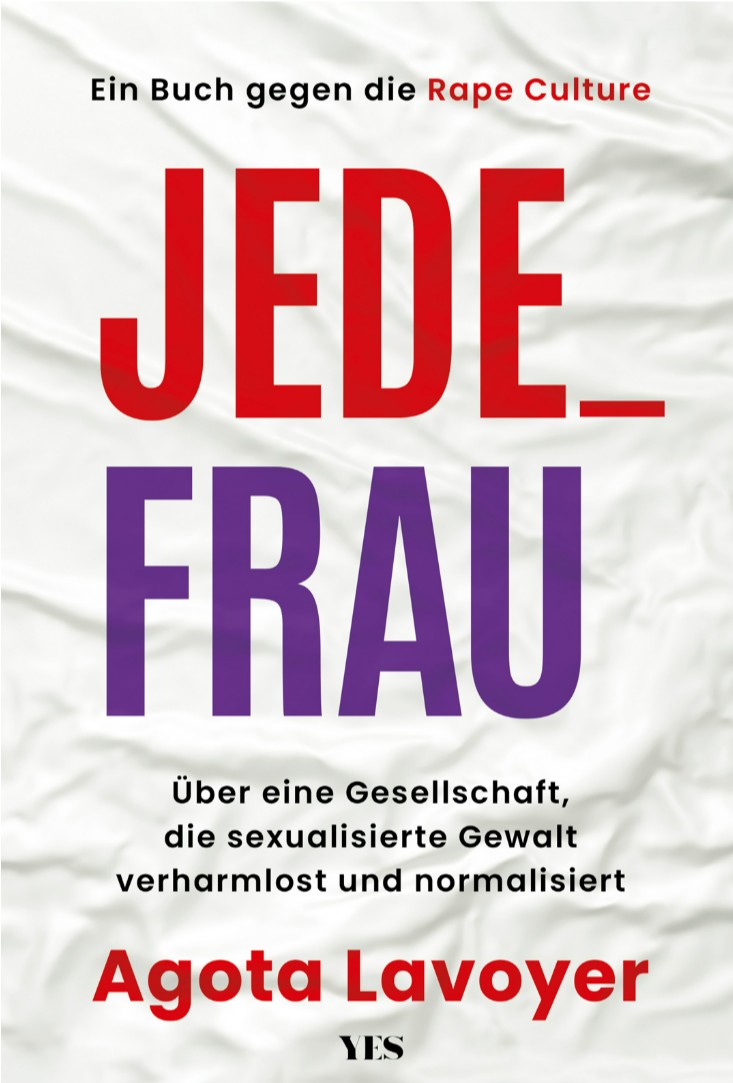Bild: © David Fürst
«Betroffene sollen wissen, dass es okay ist, nie zu vergeben»
Agota Lavoyer entlarvt sexualisierte Gewalt als strukturelles gesellschaftliches Problem. Die Kirche sei mit ihren rigiden Machtasymmetrien, Abhängigkeitsverhältnissen und fehlenden Kontrollmechanismen besonders davon betroffen.
Was verstehen Sie unter sexualisierter Gewalt?
Agota Lavoyer: Ich verwende den Ausdruck als Überbegriff für alle Formen sexueller Grenzverletzungen. Jede Handlung, die die sexuelle Integrität eines Menschen verletzt, ist eine Form der sexualisierten Gewalt. Darunter fallen Gesten, Mimik, verbale Aussagen oder körperliche Übergriffe. Von schlüpfrigen Bemerkungen über Nachrufen auf der Strasse, Verschicken von unerwünschten Intimbildern bis hin zur Vergewaltigung.
Ihr neuestes Buch haben Sie gegen das Phänomen der «Rape Culture» geschrieben. Was bedeutet dieser Begriff?
Er bedeutet nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Männer Vergewaltiger sind. Er bedeutet auch nicht, dass unsere Gesellschaft sexualisierte Gewalt befürwortet. Der Begriff «Rape Culture» drückt aus, dass sexualisierte Gewalt durch eine Kultur ermöglicht wird, die sie verharmlost oder gar ignoriert. Die Betroffene abwertet, stigmatisiert, sie häufig beschämt und zum Schweigen bringt. Gleichzeitig werden in dieser Kultur Täter entschuldigt, entlastet und ihre Taten vertuscht. «Rape Culture» wird ermöglicht durch das Wegschauen und Schweigen jedes und jeder Einzelnen.
Worin gründet diese Kultur?
Ein wichtiger Teil einer patriarchal geprägten Gesellschaft ist die Verfügungsgewalt von Männern über sogenannt untergeordnete Körper, über Frauen und Kinder. Diese war lange auch gesetzlich abgesichert, zum Beispiel durch die fehlende Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe oder dem veralteten Sexualstrafrecht, das wir bis 2024 hatten. Freud etwa hat die These vertreten, dass sich der Mann aufgrund seiner Triebe entladen müsse, damit sich bei ihm kein sexueller Überdruck aufbaue und erklärte somit sexualisierte Gewalt zu einem unkontrollierbaren und biologisch notwendigen Vorgang. Zudem behauptete er, dass Frauen sich deshalb nicht gegen Vergewaltigungen wehrten, weil es sie insgeheim erregte. Heute sind all diese biologistischen Erklärungen für sexualisierte Gewalt widerlegt. Viel mehr hat sexualisierte Gewalt kulturell bedingt Ursachen: Männlichkeitsvorstellungen, Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, Sexismus, Frauenfeindlichkeit.
Welche Rolle spielt dabei die katholische Kirche?
Die katholische Kirche ist traditionell eine sehr hierarchisch-patriarchale Institution. Die Entscheidungsgewalt liegt fast ausschliesslich bei Männern, Frauen haben nur eingeschränkte Teilhabe an Macht und Gestaltung. Geschlechterstereotype werden göttlich legitimiert: Der Mann ist der Frau überlegen, die Frau hat die passive Rolle der Gebenden, Fürsorglichen, Dienenden, weil Gott dies so will. Hinzu kommen die Kontrolle und Tabuisierung der weiblichen Sexualität in der Kirche. All das müsste ändern, um die «Rape Culture» zu entkräften, und das ist schwierig, wenn dies vermeintlich von Gott gegeben ist.
Hier werden Betroffene gehört
Unabhängige Anlaufstellen für Betroffene in der Deutschschweiz ist die Opferhilfe Schweiz. Eine Übersicht der kantonal anerkannten Opferberatungsstellen finden Sie auf www.opferhilfe-schweiz.ch. Diese sind seit Januar 2025 formell für die Beratung von Opfern von Missbrauch im kirchlichen Umfeld zuständig und lösen die kirchlichen Opferberatungsstellen ab.
Hier finden Sie eine Übersicht zu den Selbsthilfegruppen.
Wenn Sie bereit sind, über sexuellen Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche zu Forschungszwecken zu berichten, melden Sie sich bitte unter: (deutsch), (französisch) oder (italienisch).
Wie funktionieren patriarchal geprägte Institutionen wie die katholische Kirche?
Charakteristisch darin sind Männerbünde – ich nenne sie auch männliche Monokulturen – in denen Männer Privilegien ausschliesslich untereinander weitergeben. Um das zu rechtfertigen, wird alles weiblich Konnotierte abgewertet – in der breiten Gesellschaft biologistisch begründet, in der Kirche zusätzlich theologisch. In dieser Logik sind Männer die Subjekte, Frauen und ihre Körper die Objekte, über die verfügt werden darf. Die Frau hat ein reines Wesen zu sein, mit Maria, der jungfräulichen Mutter, als Idealbild.
Vor zwei Jahren wurde die Pilotstudie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche publiziert. Wie haben Sie das Ereignis wahrgenommen?
Das Ergebnis hat mich nicht erstaunt. Das Ausmass an sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft ist gross. Jede achte Frau berichtet, dass sie vergewaltigt worden ist. Jedes siebte Kind erfährt sexualisierte Gewalt. Alle Frauen erleben irgendwann eine sexuelle Belästigung. Die Kirche ist von dieser sexualisierten Gewalt nicht ausgenommen. Im Gegenteil: die rigiden Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnisse in der Kirche, die fehlenden Kontrollmechanismen führen zu einer gewaltgewährenden Kultur.
Haben Sie in während Ihrer Arbeit in der Opferberatung Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sexualisierte Gewalt im Umfeld der Kirche erlebt haben? Gibt es Spezifika?
Es lohnt sich, auf die Eigenheiten verschiedener Orte zu schauen, wo sexualisierte Gewalt geschieht, um die Menschen besser schützen und unterstützen zu können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sexualisierte Gewalt im kirchlichen Milieu spiritualisiert wurde. «Gott will das so», sagten die Täter, oder «Diese Liebe, die du durch mich erfährst, ist die Liebe Gottes». Die Täterstrategien waren so geartet, dass Gewalt unter dem Deckmantel der göttlichen Fürsorge verübt wurde.
Viele Betroffene haben nicht über den Missbrauch gesprochen oder erst nach Jahrzehnten. Warum ist es im kirchlichen Kontext so schwierig über sexualisierte Gewalt zu sprechen?
Ermutigt.
«Mit sensiblem und inklusivem Blick geben die Expert:innen Agota Lavoyer und Sim Eggler in diesem Handbuch Antworten, die ermächtigen und stärken sollen. Sie unterstützen Betroffene darin, die Gewalt einzuordnen und ihre Reaktionen zu verstehen. Die Autor:innen zeigen auf, was Betroffene tun können und welche Unterstützungsangebote ihnen in der Schweiz offenstehen.»
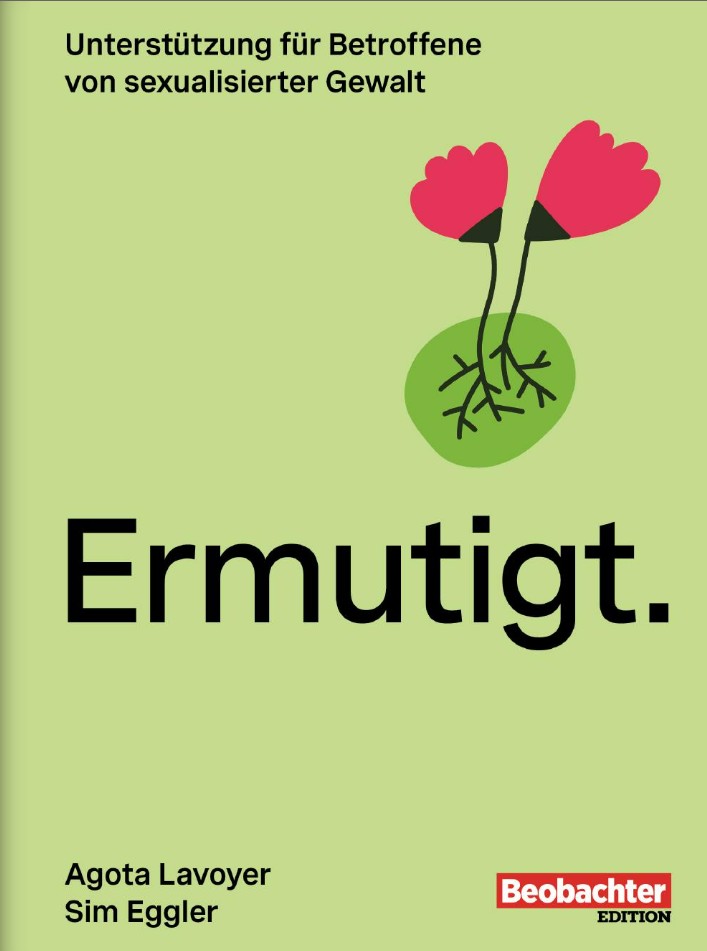
Das ist ein weiteres Spezifikum. Im kirchlichen Umfeld ist es noch schwieriger über sexualisierte Gewalt zu sprechen, weil Menschen, die religiös sozialisiert worden sind, oft die Sprache fehlt, um über Sexualisiertes zu sprechen. Sexualisierte Gewalt erfahren zu haben fühlt sich für viele als Sünde an. Das Sprechen über sexualisierte Gewalt löst dann grosse Schamgefühle aus. Ausserdem habe ich einige Betroffene beraten, die sich innerhalb der Kirche Gehör verschaffen wollten, die nicht gehört oder deren Erlebnisse verharmlost oder vertuscht wurden. Und schliesslich ist der Vertrauensverlust in die Kirche für die Betroffenen immens, weil sie vielleicht auch ihre spirituelle Heimat verlieren.
Gibt es weitere Eigenheiten im kirchlichen Umfeld?
Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass im kirchlichen Umfeld Konzepte wie Reue oder Vergebung einen immensen zusätzlichen Druck auf die Betroffenen ausüben. Um eine solche Gewalttat verarbeiten zu können, muss kein Opfer dem Täter vergeben Womöglich ist es für eine Betroffene sehr wichtig, zu vergeben. Das ist okay. Ich wünsche mir aber, dass Betroffene wissen, dass es auch okay ist, nie zu vergeben.
Welche Rolle spielt für Sie das Zölibat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt im kirchlichen Umfeld?
Ich glaube, im Zölibat einen Grund zu suchen, ist zu einfach. Ein enthaltsam lebender Mensch kann sich wie jeder andere Mensch in jedem Moment entscheiden, Gewalt auszuüben oder nicht und die körperliche Integrität seines Gegenübers zu respektieren oder nicht.
Sie analysieren die mediale Berichterstattung über sexualisierte Gewalt. Wie wird im Umfeld der Kirche berichtet?
Zu Vorfällen in der katholischen Kirche wird ebenso wie zu anderen Fällen immer wieder verharmlosend berichtet. Zum Beispiel wird die Gewalt nicht klar benannt. Der Titel lautet dann: «Skandal in der Kirche» oder «Me-too-Vorfälle in der Kirche», «Sexopfer in der Kirche». Da wird «Gewalt» mit «Sex» ersetzt, vielleicht um mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder auch um zu verharmlosen. Zudem bekommt die Opferperspektive viel zu wenig Raum. Im Allgemeinen wird über sexualisierte Gewalt als Einzelfall berichtet. Bei der Publikation der Studie wurde hingegen klar, dass die über 1000 Betroffenen keine Einzelfälle sind, sondern dass die sexualisierte Gewalt strukturell ist.
Worauf ist bei einer sensiblen Berichterstattung zu achten?
Es ist wichtig, dass die Betroffenen aus einer ermächtigten Perspektive berichten können. Das beginnt schon bei der Bebilderung eines Artikels. Die Darstellung eines Ministranten, der auf einer dunklen Treppe kauert und sich die Ohren zuhält, triggert und schwächt Betroffene. Stattdessen könnte eine Person abgebildet werden, die sich Hilfe holt, sich jemandem anvertraut. Betroffene sollen durch die Berichterstattung ermutigt werden.
Was können wir gesellschaftlich tun, um gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen?
Es geht darum, Betroffene von sexualisierter Gewalt bedingungslos zu unterstützen. Wir müssen ihnen signalisieren, dass sie über ihre Erfahrung sprechen dürfen, dass wir ihnen glauben und dass sie sicher sind. Wir wissen, dass sich nur jede zehnte Frau, die von sexualisierter Gewalt betroffen ist, Unterstützung sucht und eine Meldung macht. Das muss sich ändern. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von sexualisierter Gewalt und die Haltung, dass diese in allen Formen abzulehnen ist. Ausserdem müssen wir die Bilder von Männlichkeit revidieren. So lange wir Geschlechterhierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse haben, so lange Dominanz eine entscheidende Qualität von Männlichkeit ist und Narrative kursieren, dass Männer Frauen erobern müssen oder Männer von Natur aus oder Gott gegeben mehr zu sagen hätten, solange werden wir sexualisierte Gewalt nicht vermindern können. Das gelingt erst dann, wenn wir an den gesellschaftlichen Machtverhältnissen rütteln.
Dann tut sich die Kirche selbst einen Gefallen, wenn sie für Gleichberechtigung in ihrer Institution sorgt.
Unbedingt! Ohne Gleichberechtigung werden wir keine gewaltfreie Gesellschaft sein. Es ist nicht möglich, Gewalt in der Kirche zu verhindern, solange sie nicht gleichberechtigt ist.
Jede_Frau
«Mit scharfem Blick zerpflückt Agota Lavoyer unseren Umgang mit sexualisierter Gewalt. Sie kombiniert Statistiken und Forschungsergebnisse mit zahlreichen Beispielen aus der Populärkultur, der Strafverfolgung und der Medienberichterstattung, räumt mit gängigen Mythen auf und zeigt, dass sexualisierte Gewalt kein Ausrutscher oder Missverständnis ist, sondern Teil des toxischen Konstrukts patriarchaler Männlichkeit, das unsere Gesellschaft immer noch prägt.»