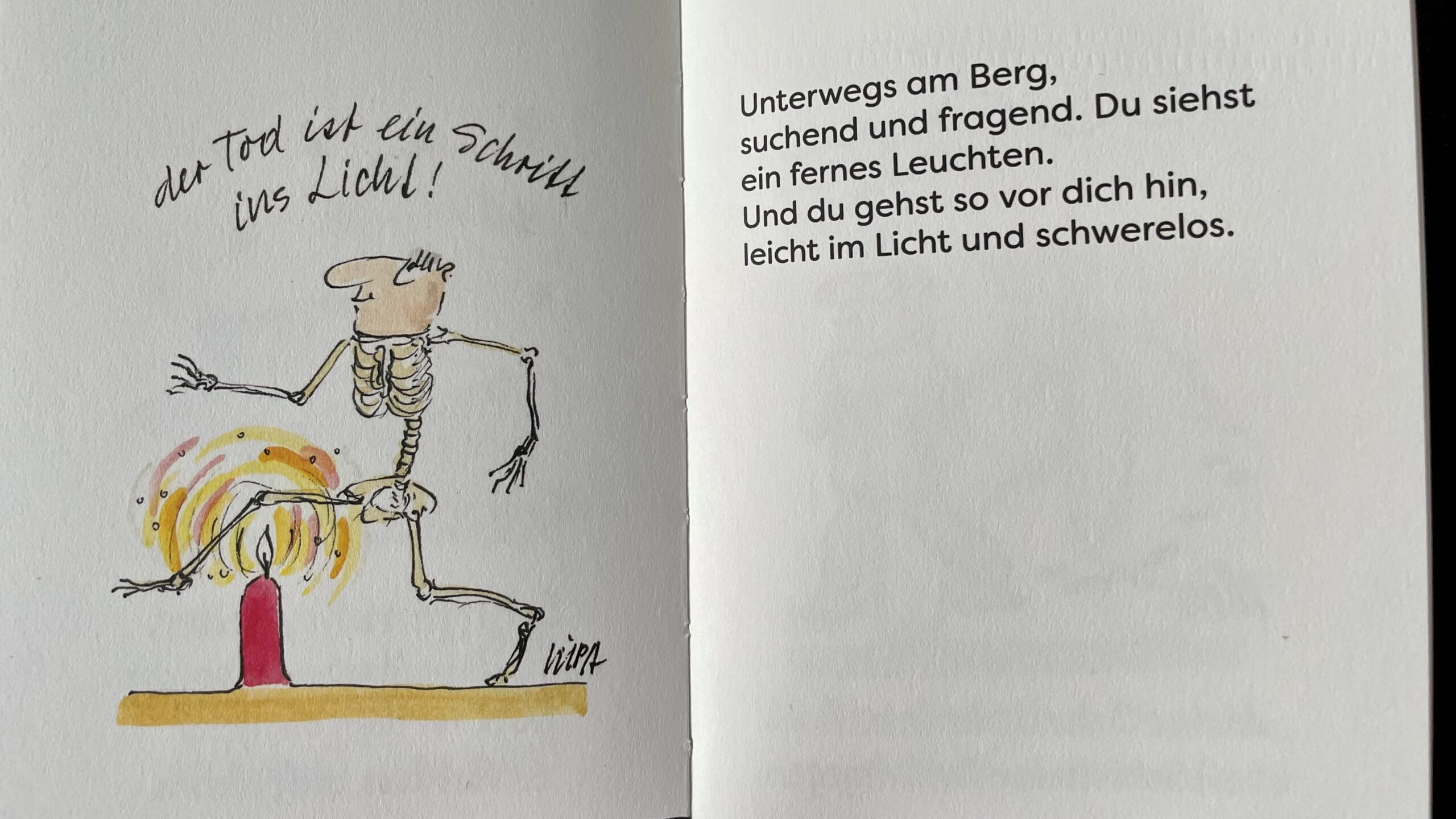pro pallium entlastet Familien mit schwerstkranken Kindern
- Ist ein Kind schwerstkrank, belastet dies die Familie enorm. Häufige Spitalbesuche, pflegerische Arbeiten, zu wenig Zeit füreinander. Neben dem Haushalt fallen zusätzliche organisatorische Arbeiten an. Die Belastung ist gross. Zeit, um Verschnaufen zu können, fehlt häufig.
- In dieser schwierigen Situation erhalten Betroffene kostenlose Unterstützung von pro pallium. Die Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene, bildet freiwillige Helfer aus und entlastet so Familien im Alltag. Zudem beraten und begleiten die Fachleute die Eltern bis über den Tod ihres Kindes hinaus.
- pro pallium zeigt, dass es im Bereich der palliativen Pflege doch einige Unterschiede zwischen der Betreuung von Erwachsenen und der Kinder Palliative Care gibt.
Frau Mackuth-Wicki, pro pallium ist eine Schweizer Palliativstiftung für Kinder und junge Erwachsene. Was genau ist ihre Aufgabe?
Cornelia Mackuth-Wicki: Wir bei pro pallium verstehen unseren Einsatz im psychosozialen Bereich, indem wir, wenn gewünscht, bereits frühzeitig zur Entlastung in die Familien gehen. Wenn ein Kind krank ist, betrifft dies die ganze Familie. So gilt es hinzuschauen, hinzuhören, was für die betroffene Familie unterstützend und entlastend sein könnte: Zeit mit dem kranken Kind zu verbringen, damit die Mutter für sich Besorgungen erledigen oder in Ruhe duschen kann, Unternehmungen mit dem Geschwisterkind durchzuführen, damit dieses ungeteilte Aufmerksamkeit in einer belasteten Zeit erfahren darf.
Wie viele Familien betreut pro pallium in der Schweiz? Im Aargau?
Aktuell begleiten wir im Bereich «pro pallium Familienbetreuung» mit unseren Freiwilligen 58 Familien in der Deutschschweiz, davon 11 im Kanton Aargau. Wir sind ausschliesslich spendenfinanziert.
Palliative Care bei Kindern bedeutet die Betreuung eines schwerkranken Kindes, ihm die bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen bis zum Ende. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Palliative Care bei Kindern meint, dass mit Beginn und Diagnosestellung einer unheilbaren Erkrankung (oftmals haben die seltenen Krankheiten bei Kindern nicht einmal einen Namen) das Kind und seine Familie Begleitung erfahren. Es gibt nicht ein entweder kurativ (heilend) oder palliativ (lindernd) sondern idealerweise ein miteinander. Mit zunehmender Erkrankung nimmt dann auch die palliative Betreuung zu, insbesondere die Linderung bei belastenden, leidvollen Symptomen. Durch den frühzeitigen Einbezug der Palliative Care kann der Fokus auf das Wesentliche gerichtet werden: die Lebensqualität des Kindes und seiner Familie.
Sie unterscheiden vier Gruppen der Palliative Care bei Kindern, welche?
Bei der Gruppe 1 handelt es sich um Kinder, welche eine lebensbedrohliche Erkrankung erleiden wie beispielsweise Krebs, aber die Option haben, geheilt zu werden. Bei der Gruppe 2 werden Krankheiten erfasst, welche lebenslimitierend sind, aufgrund der medizinischen Fortschritte jedoch lebensverlängernde und oftmals unterstützende Therapien erhalten, mit der die Betroffenen besser leben können — also beispielsweise Kinder, die mit Herzerkrankungen geboren werden und lindernde Operationen bis hin zu Herztransplantationen erfahren. In der Gruppe 3 werden Kinder mit fortschreitenden Erkrankungen dazu gerechnet. Diese Kinder leiden unter ständigen Verschlechterungen, beispielsweise Gendefekte und Stoffwechselerkrankungen. Die Gruppe 4 sind Kinder mit irreversiblen Schädigungen, das heisst, langjährigen schwerwiegenden Erkrankungen wie beispielsweise eine Cerebralparese.
Gibt es Unterschiede zwischen der Palliative Care bei Erwachsenen und der Palliative Care bei Kindern?
Die Begleitungen sind meist länger andauernd, manchmal auch über Jahre. Häufig wissen wir beim Einsatzbeginn nicht, wie sich der Gesundheitszustand des Kindes entwickelt. Während bei den Erwachsenen in der Palliative Care häufig Sterbebegleitungen im Zentrum stehen, also die Begleitungen in der End-of-life-Phase eines Menschen, sprechen wir bei Kindern mehr von Lebensbegleitungen und fokussieren auf die qualitative Lebenszeit des Kindes und seiner Familie. Wenn ein Kind in die letzte Lebensphase tritt, verkleinert sich der Kreis der involvierten Menschen, welche vor Ort beim Kind sind und das ist richtig so. Unsere Begleitungen zielen dahin, dass die Familie bei dem sterbenden Kind sein kann und darüber hinaus Kraft für das Weiterleben hat.
Oftmals stirbt ein Kind nach langer Betreuungszeit. Was bedeutet das für das Team?
Mit den Einsätzen in den Familien bei den Kindern wächst die Beziehung und für die Freiwilligen ist es hilfreich, wenn sie anlässlich der Austauschtreffen in ihrer Region über ihren Einsatz und den Tod des Kindes sprechen dürfen. Das wirkt entlastend. Im Rahmen dieser Austauschtreffen findet ein Abschiedsritual für die betreffende Freiwillige statt. Das stärkt das gemeinsame Tragen und den Zusammenhalt im Team. Die Freiwilligen besuchen die Familien, deren Kind verstorben ist, in der Regel auch weiter und widmen sich den Geschwistern oder Eltern, wenn das gewünscht ist. Neue Einsätze übernimmt die betreffende Freiwillige erst, wenn sie das möchte.
Wir durften für Horizonte eine Familie in Suhr besuchen, dessen Kind am Williams Beuren Syndrom erkrankt ist. Ein Gendefekt, welcher sicherlich Betreuung braucht, nicht aber lebensbedrohlich ist. Wieso kommt hier trotzdem pro pallium zum Einsatz?
Grundsätzlich ist dieses Syndrom nicht heilbar, je nach Begleiterkrankungen, die mit dem Syndrom einhergehen können, ist ein Kind dementsprechend mehr oder weniger beeinträchtigt. Wenn eine derartige Erkrankung vorliegt, gibt es im Verlaufe dieser stabilere und krisenhaftere Abschnitte. pro pallium hilft mit, diese instabilen Momente im Familiengefüge aufzufangen und im Alltag zu begleiten. Solche Einsätze sind dann von unterschiedlicher Dauer und können auch wieder beendet werden, ohne dass das Kind verstirbt.
Gibt es noch andere solche Fälle, wo pro pallium Unterstützung dieser Art leistet?
Gerade bei Kindern in der erwähnten Gruppe 4 kann es langandauernde Phasen mit stabilem Gesundheitszustand geben. Wir sind da im Kontakt mit Familien, wo wir in Akutsituationen mittragen helfen und uns dann wieder zurückziehen, bis sie uns bei Verschlechterungen wieder kontaktieren.
Bei der Familie in Suhr mussten Sie lange nach einer freiwilligen Helferin suchen.
Es kommt hin und wieder vor, dass Familien länger warten müssen, weil beispielsweise keine Freiwillige in der Gegend lebt – wir rechnen mit Wegzeiten von bis zu ¾‑1 h pro Weg
. Es ist uns wichtig, dass es für die betroffenen Kinder und jungen Erwachsenen sowie für deren Familien und die Freiwilligen stimmig ist.
Inzwischen ist pro pallium einmal pro Monat mit einer Helferin vor Ort. Entspricht dies den normalen Einsatzzeiten?
Dass in Suhr die Freiwillige nur ein Mal pro Monat im Einsatz ist, gehört eher nicht zur Regel. Im vorliegenden Fall passt es für beide Seiten. Gerade bei kleineren Kindern ist es wichtig, dass sich die Beziehung durch regelmässige wöchentliche oder mindestens zweiwöchentliche Besuche festigen kann.
Brauchen Sie vielleicht mehr freiwillige Helferinnen und Helfer?
Der Bedarf an Entlastung und Begleitung durch unseren ambulanten Kinderhospizdienst ist von Seiten der Familien weiter hoch und wir haben mehr Anfragen von Familien, als wir mit unseren Freiwilligen abdecken können. Aktuell haben wir 95 Freiwillige, von denen sich etwa ein Drittel «im Einsatzstopp befinden», und zusätzlich 18 Freiwillige in der Basisschulung.