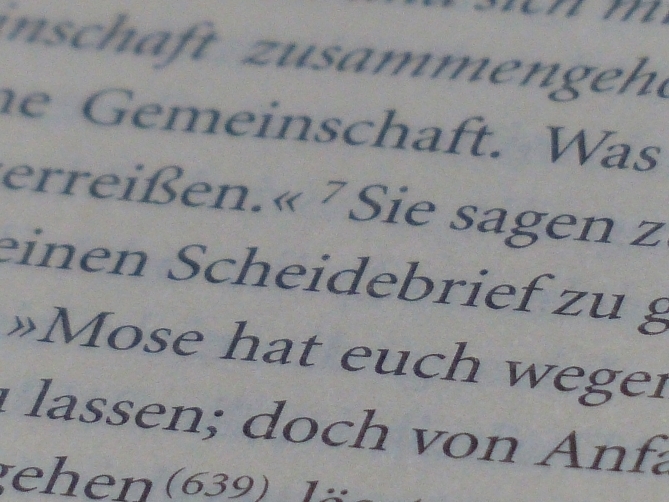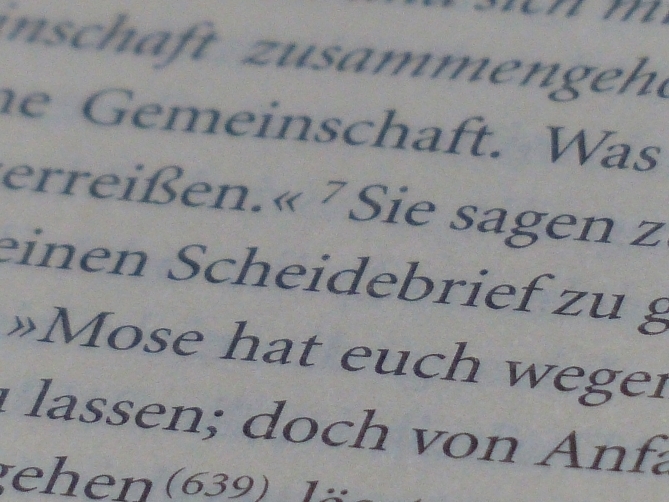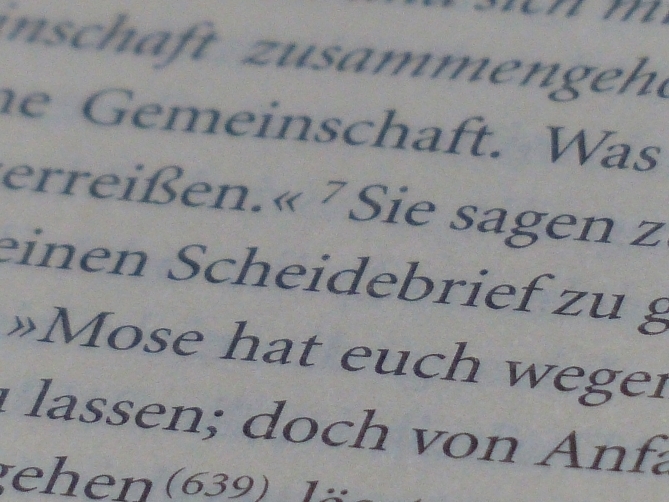Im antiken Judentum und auch im Römischen Reich gab es ein formalisiertes Scheidungsrecht. Für die Jesus-Nachfolgegemeinschaft stellte sich bald einmal die Frage, wie sie den Umgang mit Beziehungskrisen in ihren Reihen regeln wollte – zumal die gemeinsame Nachfolge von Frauen und Männern in engem Kontakt miteinander selbstverständlich war, aber auch zu herausfordernden Situationen führen konnte.Die Spannbreite der Ansichten ist dabei recht gross. Das gilt natürlich auch für die auf Jesus persönlich zurückgeführten Sätze. Gerade der bekannte Satz «Was nun Gott zusammengefügt hat, darf/soll der Mensch nicht trennen» (Mk 10,9; Mt 19,6) – bei dem nur schon die Übersetzung mit «darf» oder «soll» eine wichtige Nuance bildet – steht neben anderen Aussagen, die Situationen aufzählen, in denen dann doch geschieden werden darf (z.B. Mt 5,32; 19,9; 1 Kor 7,10–16).
In einem neuen Licht
Offenbar kommt es selbst in dieser wichtigen Frage, bei der Jesus mit dem göttlichen Schöpfungswillen argumentiert (Mk 10,6–8; Mt 19,4–6), auf den Einzelfall und seine konkreten Umstände an. Genau solche konkreten Umstände von Einzelfällen hat Luzia Sutter Rehmann, Professorin für Neues Testament an der Universität Basel, untersucht. Und sie hat bei der genauen Lektüre von Mk 10,1–12 – eine der wichtigsten Stellen zum Thema, die auch einige der oben bereits zitierten Aussagen enthält – eine Entdeckung gemacht, welche die entsprechende Textstelle in ein neues Licht stellt. Luzia Sutter Rehmann ist aufgefallen, dass das Markusevangelium die Diskussion um Trennung und Scheidung in einen Zusammenhang mit dem Weg Jesu und seinen Jüngerinnen und Jüngern nach Jerusalem stellt (Mk 10,1f): «Von dort [Galiläa] brach Jesus auf und kam nach Judäa und in das Gebiet jenseits des Jordan. Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen?»
Geografisch verortet
Diese Situation, der Weg Jesu nach Jerusalem, ist der Ausgangspunkt. Und das findet Luzia Sutter Rehmann wesentlich. Denn mit dieser scheinbar nur geografischen Angabe ist die ganze folgende Diskussion im Grenzbereich zwischen Galiläa und Judäa verortet. Diese Bezirke hatten aber eine wichtige Bedeutung im jüdischen Eherecht. So konnte ein Ehemann seine Frau beispielsweise nicht zwingen, mit ihm in einen anderen Bezirk umzuziehen. Andererseits durfte niemand am Umzug in die Heilige Stadt Jerusalem gehindert werden. Wenn sich Ehepaare über ihren gemeinsamen Lebensort nicht einigen konnten, durfte das notfalls auch zur Trennung oder Scheidung führen. Luzia Sutter Rehmann vermutet, dass dies der Hintergrund der Frage der Pharisäers ist: Wenn eine Frau mit Jesus nach Jerusalem ziehen will – darf ihr Mann sie dann aus der Ehe entlassen?
Nicht auf der Scheidung bestehen
Vor diesem Hintergrund, so Luzia Sutter Rehmann, argumentiert Jesus nun, die betroffenen Menschen sollten sich in ihrer Beziehungskrise am Schöpfungswillen Gottes orientieren und ihre Ehe nicht vorschnell auflösen, sondern nach einer gemeinsam, tragfähigen Lösung suchen. Der gegebenenfalls zurückbleibende Ehepartner soll nicht hartherzig auf der Scheidung bestehen. Und auch der mit Jesus nach Jerusalem mitziehende Ehepartner soll sich nicht als geschieden ansehen, sondern die Möglichkeit einer Rückkehr an einen gemeinsamen Lebensort offen halten. Die Aufforderung Jesu, eine Ehe nicht vorschnell in Frage zu stellen, wird damit nicht zum absoluten Ehescheidungsverbot, sondern zur Einladung, schwierige Ehezeiten und unterschiedliche Lebensentwürfe im Lichte der Tora und der Jesusnachfolge partnerschaftlich anzugehen.
Mehrere Lesarten
Es ist schwer zu entscheiden, ob Luzia Sutter Rehmann mit ihrer Interpretation des Textes aus historischer Perspektive Recht hat. Das ist aber auch die falsche Frage: Es gibt nie nur eine richtige Deutung von Bibelstellen! Die jüdische Schriftauslegung, in der Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger tief verwurzelt waren, spricht später davon, dass die Tora siebzig verschiedene Gesichter habe, mit der sie die Lesenden anschaut. Es geht also darum, dass wir im aufrichtigen Gespräch mit unseren heutigen Lebenssituationen und den Glaubens- und Lebenszeugnissen der Bibel nach Wegen suchen, die für alle Beteiligten zu mehr «Leben in Fülle» führen (Joh 10,10). Auch in Fragen von Lebens- und Beziehungskrisen, Trennung, Scheidung und Wiederheirat.Peter Zürn und Detlef Hecking/aj